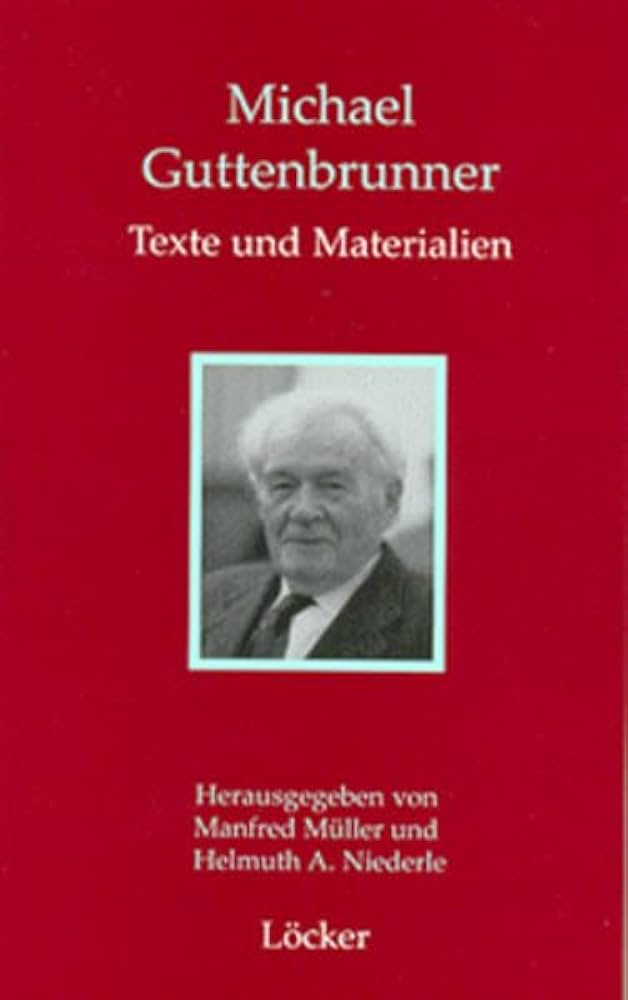Die erste Hälfte des Buches versammelt einige (?) Beiträge des Symposiums zu Ehren Michael Guttenbrunners in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, die immer wieder Tagungen und Veranstaltungen auch für Autorinnen und Autoren organisiert und ausrichtet, die im Literaturbetrieb weniger integriert sind und nicht für eine Eventkultur taugen. Die Tagung fand im Mai 2004 statt, knapp vor Guttenbrunners Tod und nur einen Monat nach der Verleihung des Theodor Kramer-Preises. Das ist der in Österreich gar nicht so häufige Fall, dass die Ehrung eines greisen Autors gerade noch rechtzeitig zu Lebzeiten erfolgte.
Dieser erste Teil umfasst wissenschaftliche Aufsätze von Klaus Amann, Eckart Früh, Daniela Strigl und Christian Teissl und eine persönliche Anmerkung von Antionio Fian. Wie schräg Michael Guttenbrunner im Literaturbetrieb wahrgenommen und verankert war, macht Klaus Amann in seinem einleitenden Beitrag deutlich. Der Aachener Rimbaud Verlag, in dem seit 1994 mehr als zehn Bücher Guttenbrunners erschienen sind, verwendete bei den letzten drei Publikationen seines Hausautors als Werbemaßnahme einen Vergleich mit dem Schweizer Autor Ludwig Hohl. Dieser Vergleich, so legt Amann Punkt für Punkt dar, ist nicht nur in keiner Beziehung haltbar, Guttenbrunner selbst hat in einem seiner „Machtgehege“-Bände, die mit diesem Werbespruch versehen sind, vehement dagegen polemisiert. Das Verhältnis Verleger – Autor scheint keineswegs nur in den großen Verlagskonzernen in den letzten Jahrzehnten schwer gelitten zu haben.
Vielleicht der spannendste Beitrag des Bandes ist Eckart Frühs Blick auf das Verhältnis von Guttenbrunner und Johann David Sauerländer, einem deutschen Juristen und Richter, der nach der Machtübernahme 1933 einen radikalen Rückzug aus seinen Ämtern einer Korrumpierung durch das Regime vorzog und in seinen Schriften und Äußerungen ein erstaunlich hohes Maß an Zivilcourage bewies. Guttenbrunner hat Sauerländer wiederholt – auch dessen Texte einmontierend – ein literarisches Denkmal gesetzt; ein Beispiel dafür ist im zweiten Teil unter dem Titel „Über den Tod“ nachzulesen. Eckart Früh hat seinerseits Michael Guttenbrunner ein editorisches Denkmal gesetzt, indem er seit 1997 seine unregelmäßig erscheinenden, umfangreichen und bibliographisch aufbereiteten Archivfundstücke unter dem Titel „Spuren und Überbleibsel“ erscheinen lässt; „Spuren und Überbleibsel“ war der Titel von Guttenbrunners erstem Gedichtband, der 1947 im Klagenfurter Kaiser Verlag erschien und der, so Michael Guttenbrunner, im „Winter 1945/46 in einem Irrenhaus verfaßt [wurde], in das ihn ein Offizier der Besatzungsmacht eingewiesen hatte, nachdem er beleidigt worden war.“
Zentral für das Verständnis von Guttenbrunners Werk ist auch der Aufsatz von Daniela Strigl, die sein „Griechenland-Erlebnis“ analysiert. Guttenbrunner hatte im Mai 1941 die deutsche Eroberung Kretas mitgemacht und war in der Folge wegen Insubordination in Militärarrest gekommen. Dort lernte er den griechischen Dichter Jannis Ritsos kennen. Das Erlebnis von Krieg und Besatzerbestialität hat Guttenbrunner ebenso ein Leben lang nicht los gelassen, wie das Griechenland der Antike und die zeitgenössische griechische Literatur.
„Guttenbrunner war nie im Exil, aber immer im Widerstand“, schreibt Daniela Strigl in ihrer Laudatio auf den Autor, und die ebenfalls abgedruckte Dankesrede Guttenbrunners ist dafür ein guter Beweis: Auch die Textsorte Dankesrede hielt ihn nicht davon ab, Theodor Kramer, für dessen Rückkehr aus dem Exil er sich einst massiv eingesetzt hatte, nicht nur Gutes und Höfliches nachzusagen. Im Punkt Rücksichtslosigkeit bis hin zu Handgreiflichkeiten und nachfolgenden Gerichtssachen erinnert Michael Guttenbrunner durchaus an einen anderen alten Herrn der österreichischen Literatur – doch mit der Herrenreiter-Allüre eines Alexander Lernet-Holenia wollte er sicher nichts zu tun haben.
Nach diesem Zwischenstück folgt im Buch der zweite Teil mit „großteils unveröffentlichten“ (so heißt es in der einleitenden editorischen Notiz) Texten, die den Leser etwas ratlos zurücklassen, da weitere Angaben fehlen. Das ist bedauerlich, aber auch verständlich. Guttenbrunners Arbeit an seinen Textsteinbrüchen, aus denen er immer wieder Bausteine herauszog, verwendete, wiederverwendete, neu bearbeitete und umschrieb, macht verlässliche textkritische Nachweise zweifellos schwierig. Lesenswert sind die Texte in jedem Fall. Die Themen reichen von herzerfrischend polternder Architekturschelte – wider Hollein und Hundertwasser – bis zu autobiographischen Fragmenten, Analysen und Statements zu Nestroy und immer wieder zu Karl Kraus. Der ist auch dort präsent, wo Guttenbrunner fein und hellhörig die (Alltags)Sprache nach Spuren und Überbleibseln der NS-Vergangenheit untersucht oder das Schale und Marktkonforme des aktuellen „Vergangenheitsbewältigungs“-Hypes in Grund und Boden schimpft. Und genau deshalb fehlt Michael Guttenbrunners Stimme schon heute – und umso wichtiger sind Publikationen wie die vorliegende.