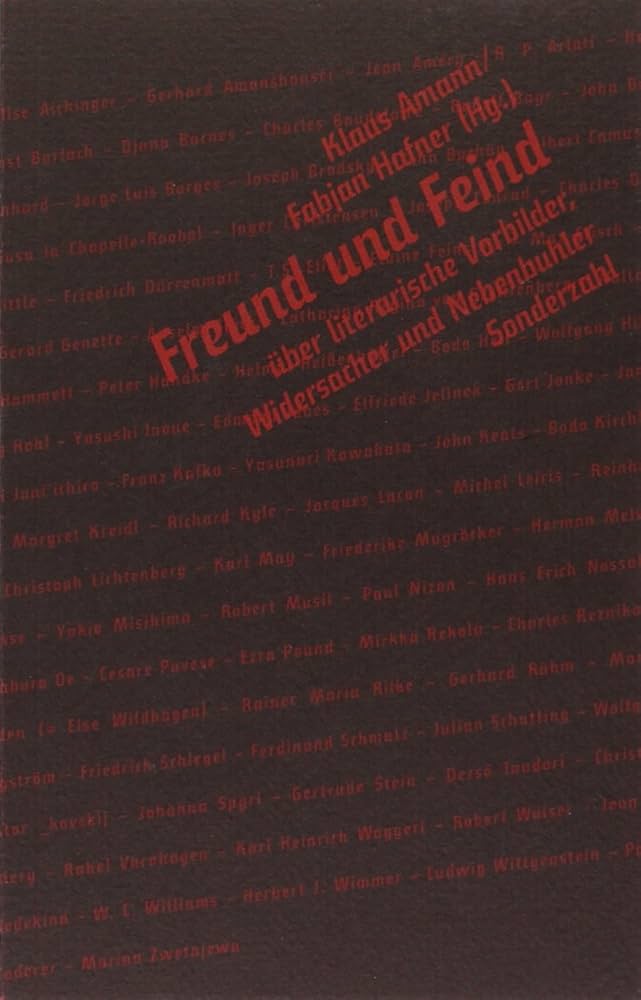Das Vorwort allerdings setzt nicht bei Fragen nach ästhetischen Differenzen, nach Vorbildern und reflektiertem Handwerk an. Dort geht es zunächst in unsicheres Gelände, in das so schwer zu fassende, spezifisch Österreichische der österreichischen Literatur nämlich, ihre schwierige Identität und Positionierung inmitten des deutschsprachigen Markts, die historisch-literarisch wie politisch falschen Umarmungen und Ausrutscher. Das ist bekannt. Deshalb: geschenkt! Am Ende der Einleitung wurden jedenfalls Thema und Beiträge – und sei’s auf Biegen und Brechen – auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Es gehe, so Klaus Amann, darum, „wie liest jemand, der selbst schreibt“.
So unterschiedlich die Professionen der Beitragenden (Alois Brandstetter, Leopold Federmair, Ferdinand Schmatz, Evelyn Schlag, Helga Glantschnig, Marlene Streeruwitz, Elisabeth Reichart, Franz Josef Czernin, Kurt Neumann, Franz Schuh, Lucas Cejpek) als Schriftsteller, Kritiker, Kulturmanager, Regisseur, Wissenschaftler oder Übersetzer (und oftmals auch alles in Personalunion), so unterschiedlich auch Ansatz, Argumentation und Qualität der Artikel. Vorbilder, Widersacher und Nebenbuhler boten da manchem vor allem Gelegenheit, alte Fehden wieder aufzuwärmen und sein Mütchen zu kühlen, genauso, wie sich einmal, endlich!, selbst ins rechte Licht zu rücken; – was dann an den Fußnoten, die peinlich oft den Verfasser selbst am ausführlichsten zitieren, leicht abzulesen ist. Das alles müsste noch kein Fehler sein, läse sich durchaus amüsant und spannend, wenn jeder der Angreifenden auch das Werkzeug seiner Kritik geschliffen und sich der Mühe des Argumentierens unterzogen hätte. Doch nicht immer gestalten sich die Attacken vergnüglich, und oftmals folgt man eher der eigenen, eitlen Nabelschau als einem souveränen, weil mit gehöriger Umsicht geführten Zweikampf. Da lobt man einmal mehr Robert Gernhardt, der gleich hintersinnig titelte: „Ich Ich Ich“.
Doch wer zählt schon gern zu den Egomanen? Deshalb wählt, wer nicht den Weg der Polemik, sondern den der Objektivität einzuschlagen gedenkt, den von Rankings und Kanons flankierten Pfad literaturwissenschaftlicher Exegesen. Die fallen dann allerdings meist so kreuzbrav aus, dass man sich fragt, was sie – so verdienstvoll sie sein mögen – in diesem Buch zu suchen haben (ist der Schriftsteller N. nun des Verfassers Feind, oder geht es um die Feinde, von denen N. sich als Schriftsteller umgeben sah? Für wen sind die Subtilitäten zwischen alltäglichem und nicht-alltäglichem, von poetischem und nicht-poetischem Sprachgebrauch nun ein Vor- oder Feindbild? Wieso widmet sich ein anderer Interpret gerade den Autoren A, B und C, die, außer seine persönlichen Vorlieben zu sein, nichts miteinander zu tun haben?). Kurz, fehlt es den einen an der nötigen kühlen Wut, den anderen an der Verve, uns Lesern das Thema einsichtig und schmackhaft zu machen. Nicht selten hat man dagegen das Gefühl, hier handle es sich um Remakes, Recyceltes, Aufgewärmtes, für das Buch (oder eine Tagung?) eiligst Zusammengetragenes. Gibt es nicht mehr den von Klaus Amann ausgespähten Schriftsteller als Weltbürger, der über seine persönlichen Widersacher, Vorbilder und Nebenbuhler nicht vergisst, dass eben nur über gute und schlechte Literatur, eigene Irrtümer und Treffer zu verhandeln ist?
Doch, gibt es. Marlene Streeruwitz berichtet uns, sehr künstlich-kunstvoll und poetisch, wie sie, die einst ihren Lesehunger mit „Heidi“, „Daddy Long Legs“, „Gulla“ und Karl May stillte, trotzdem begriff, dass „Flucht immer nur in die Wahrheit gelingen kann“, und so gerade das Verschwiegene sie zur kritischen Leserin, Schriftstellerin und distanzierten Weltbeobachterin machte; oder wir imaginieren uns zusammen mit Leopold Federmair zurück in einen adoleszierenden Internatszögling, dem die Lektüre von Thomas Bernhards „Kalkwerk“ nicht nur ein packendes, gleichwohl unverstandenes Glück bedeutete, sondern ihm, dem Autor, auch noch das nötige Widerstandspotential und die Freiheit schenkte, die seine, Federmairs, Relektüre zugleich zu einer Geschichte über die Kraft von Geschichten macht. Sie zeigt: Literatur ist Literatur über Literatur, Spiel und Arbeit an der Sprache, die hoffen lässt, dass wir über unsere Ohnmacht triumphieren können, weil das Widerständige der Literatur auch unsere Kraft zum Widerstand stärkt. Schließlich entführt uns Elisabeth Reichardt auf die andere Seite der Weltkugel. Sie berichtet von ihrer Liebe zu Japan, das vertraut wurde und fremd blieb, so dass ihre Nachrichten aus diesem Land auch immer ein Stück Österreich beleuchten, eine Heimat, die unheimlich wurde und geblieben wäre, wären da nicht hier wie dort die Autoren, die die Hand ausstreckten und sie in die Fremde, nach Hause, zu sich selbst holten.
Schön wär’s gewesen, wenn diese Balance zwischen biographischem Urgrund und Abwehr des Persönlichen immer beherzigt worden wäre und folglich nicht nur auf dem Papier stünde: „Schreiben verpflichtet zur Wahrhaftigkeit, das heißt, Schonungslosigkeit sich selbst und der Gesellschaft gegenüber“. Und: „Beim Thema bleiben“. Am Ende des Sammelbandes jedenfalls hatte sich eine Prognose bewahrheitet: in den meisten Fällen nichts als „heillose Unordnung“. Schade nur, dass der Schlingerkurs zwischen „Verwirrung und Inspiration“ sich selten als erkenntnisfördernd erwies. Viel Verwirrung, wenig Inspiration.