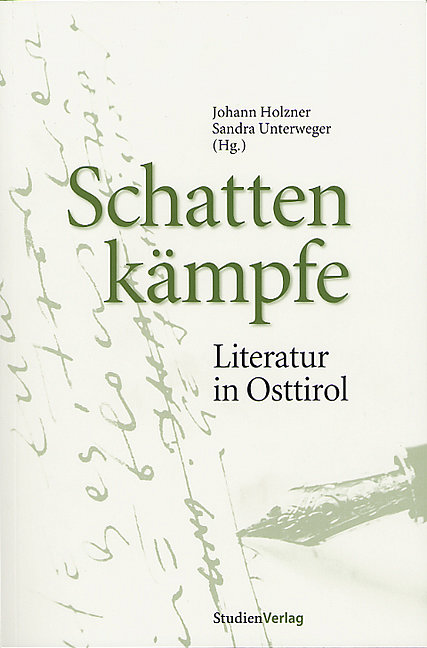Dass hier die Literaturwissenschaft dem Primärtext den Vortritt lässt, hat Konsequenz: Diese „Vermessung“ der Literaturlandschaft Osttirol, diese „erste Bestandsaufnahme“ (Holzner) will auch eine Dokumentation ihres Untersuchungsgegenstandes sein und bringt mehrere Texte von Osttiroler Literaten. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Aufsätzen (allesamt von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Innsbrucker Brenner-Instituts verfasst), darüber hinaus leistet es noch die Arbeit eines Nachschlagewerks, die wichtigsten Daten zu Bio- und Bibliographie der Autoren sind übersichtlich zusammengefasst.
Eine runde Sache also. Warum aber beschäftigt sich das Brenner-Archiv mit einem so kleinen Bezirk? Warum gibt es noch keine vergleichbaren Studien über den Bezirk Scheibbs oder die „Literatur im Lungau“? Handelt es sich hier gar um eine „kleine Literatur“ im Sinne Gilles Deleuzes und Félix Guattaris? Letzteres einmal sicher nicht, man mag zwar im Bezrik Lienz Phänomene der „Deterritorialisierung“ ausmachen, aber die rund 50.000 Osttiroler sind in ihrer Umgebung keine Minderheit wie die Prager Deutschen. Die Herausgeber sprechen natürlich nicht von einer „Osttiroler Literatur“, eine solche Zusammenfassung wäre vermessen, sie bleiben bei der geographischen Eingrenzung und führen als Beweggrund ihrer Arbeit an, diesen unbekannten Fleck der Literaturlandschaft ausleuchten zu wollen. Die Frage, ob es knapp 90 Jahre nach der Abtrennung von Südtirol Ansätze einer Osttiroler Identität gibt (was im föderalistischen Österreich nicht verwundern würde), wird hier nicht gestellt, auch wenn die Geschichtswissenschaft dies mittlerweile nahelegte (2005 erschien Martin Koflers Studie „Osttirol“, eine erste „Gesamtschau zur historischen Entwicklung“ des Bezirks). So geht das Buch „frisch“ hinein in die Details eines abgegrenzten regionalen Literaturalltags, beleuchtet die Bedingungen, unter denen in der „tiefen Provinz“ Literatur entstehen kann. „Schattenkämpfe“ blickt dabei in Ecken und Nischen, die die Literaturwissenschaft normalerweise nicht berücksichtigt, etwa Sagen, lokale Literaturinitiativen („Lienzer Wandzeitung“) oder die ländliche Dialektdichtung (und stellt dabei das – mir bislang unbekannte – Genre „Mundartroman“ vor).
Das kleine Osttirol hat literarisch viel zu bieten: Der tirolweit immer noch viel gelesene Reimmichl stammt von hier („Ein Bauernhaus ohne Reimmichl-Kalender läßt sich in Tirol nur schwer vorstellen.“ Barbara Hoiß); die (kurzfristige) Bestsellerautorin Fanny Wibmer-Pedit erkor Lienz in den dreißiger Jahren als Wahlheimat; Gerold Foidl fand mit seinem Roman „Der Richtsaal“ bei der Kritik viel Beachtung, Peter Handke brachte 1985 postum Foidls Roman „Scheinbare Nähe“ bei Suhrkamp unter (leider setzt sich keiner der Aufsätze mit der Bearbeitung und dem Ausmaß der Eingriffe Handkes auseinander); der Lienzer Christoph Zanon umkreiste auf spannende und avancierte Weise den Komplex „Heimat“; der Villgratener Johannes Trojer zeigte vor, wie man in der Abgeschiedenheit ohne Subventionen eine gute, kritische Kulturzeitschrift herausbringt („Thurntaler“). Gegenwärtig sind vor allem drei literarische Stimmen aus Osttirol zu vernehmen: Der Lyriker Hans Salcher liefert „eindringliche Bilder der Berge“, die beiden jungen Autoren Bernhard Aichner und Dietmar Eder finden viel Beachtung.
Der sympathische Zug der Publikation, sich alle Aspekte des Untersuchungsgegenstands ohne Voreingenommenheit, ohne Vorselektion anzusehen, zieht zwangsläufig auch eine Beschäftigung mit den künstlerisch uninteressanten bis inhaltlich bedenklichen Werken Franz Josef Koflers nach sich, „aber zu ihrer Zeit haben die Bücher nun einmal eine nicht unwesentliche Rolle gespielt“ (Anton Unterkircher). Und dieser Grundzug führt im Falle Reimmichls, an dem die „Schattenkämpfe“ nicht vorbei kommen, dazu, dem antisemitischen Priesterdichter auch positive Seiten abzugewinnen: Er habe die Menschen immerhin zum Lesen gebracht und sich „für originelle Käuze und soziale Außenseiter oft und oft energisch eingesetzt“ (Holzner). Anton Unterkircher zeichnet eindrücklich den Lebensweg Wibmer-Pedits nach, die sich zwischen alle Stühle – etwa die von NSDAP und katholischer Kirche – setzte und trotz beachtenswerter Verkaufserfolge zu einer tragischen Figur wurde. Sandra Unterweger relativiert mit gutem Grund die Fixierung von Gerold Foidls „Richtsaal“ auf das Diktum der „negativen Heimatliteratur“, schade nur, dass keine vergleichende Lektüre, keine Positionierung in der Literatur seiner Zeit versucht wurde. Anna Rottensteiner hat keine Scheu, die Schwachpunkte in der Literatur der Osttiroler Zentralfigur, Christoph Zanon, anzusprechen. Sandra Unterweger schießt in ihrem Aufsatz zu Zanon vielleicht etwas über das Ziel hinaus, wenn sie Zanons Lienz in eine Reihe mit Joyces Dublin stellt (auch wenn sie damit nur eine wichtige Referenz für den Autor darlegen wollte), sie verwendet zudem überlange Originalzitate und bleibt an zwei, drei Stellen zu vage, etwa wenn sie die „Problematik der Beschreibbarkeit der Wirklichkeit“ bei Zanon „an Strömungen in der österreichischen Literatur der siebziger und achtziger Jahre“ erinnert, ohne auszuführen, welche „Strömungen“ damit gemeint sind – davon abgesehen, dass Mimesis und Wirklichkeitsauffassung wohl Fragestellungen jeglicher Literatur sind. Ein klein wenig mehr analytische Sorgfalt und eine kurze Begründung, warum man am Ende genau diesen einen Text von Dietmar Eder abgedruckt hat, hätten die runde Sache vollends abgerundet. Von diesen Kleinigkeiten abgesehen sind die „Schattenkämpfe“ ein paradigmatisches Handbuch, das vorzeigt, wie man mit verschiedenen literaturwissenschaftlichen Methoden einen Untersuchungsgegenstand, in dem Fall alle Arten der in einem geographisch begrenzten Gebiet hervorgebrachten Literatur, bis in die Verästelungen hinein gut lesbar und handhabbar ausleuchten kann.