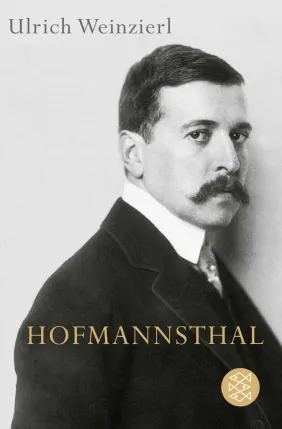Hofmannsthal war, wie viele seiner Zeitgenossen, besonders auch die Mitglieder seines Freundeskreises, ein Verschweigungskünstler, diskret und immer darauf bedacht, Spuren, wenn sie denn hinterlassen wurden, zu verwischen. An diesem vorweg formulierten Anspruch gemessen ist Weinzierls Unternehmen gelungen. Er hat jede Menge Material angehäuft, vor allem aus Briefen, die Hofmannsthal in großer Zahl schrieb und empfing, und er hat das Material grob geordnet. Drei Kapitel, drei biographische Dimensionen: Hofmannsthals Verhältnis zum Judentum, sein Verhältnis zum Adel und, bei weitem das umfangreichste Kapitel, der Freundschaftskult, wobei innerhalb der letztgenannten Dimension die Liebe einen fast untergeordneten Rang einnimmt.
Daß es wirklich so schwierig sein soll, eine Hofmannsthal-Biographie zu schreiben, wagt der Rezensent zu bezweifeln. Biographen arbeiten auf der einen Seite immer mit Hypothesen, sie versuchen, einen Lebenslauf zwischen Einheit und Vielfalt, zwischen Identität und Zerstreuung zu konstruieren und verborgene Quellen, Lebensantriebe, aber auch Lebenshemmnisse aufzudecken. Andererseits versucht der Biograph, die Ereignisse zu erzählen, chronologisch oder nicht, auf alle Fälle aber in Hinblick auf die Zeit, die jener individuellen Existenz gegeben war. Weinzierl tut beides nicht oder nur in Ansätzen, er zimmert keine Hypothesen und erzählt keinen Lebensroman. Das Porträt, zu dem er Skizzen liefert, kann sich beim Lesen nicht wirklich festigen, und Entwicklungslogiken werden kaum sinnfällig. Erläuterungen zum Werk des in Frage stehenden Autors wird man von seinem Biographen nicht in erster Linie erwarten. Dennoch könnte von der Aufarbeitung der Lebenserfahrungen her zumindest ein Licht auf Motive, thematische Obsessionen, vielleicht sogar auf die Ausdrucksformen fallen. Weinzierl begegnet seinem Gegenstand mit grundsätzlicher Achtung, scheut sich aber auch nicht, die menschlichen, allzumenschlichen Seiten ins Blickfeld zu rücken. Dennoch regt sich am Ende ganz leise die Frage, ob wir es bei Hofmannsthal wirklich mit einem so bedeutenden Autor zu tun haben, wie uns „die Literaturgeschichte“ weismachen will. In Weinzierls Sicht scheint es so etwas wie ein Zentrum von Hofmannsthals Werk zu geben, das Konversationsstück Der Schwierige. Für die frühe Lyrik und die lyrischen Dramen scheint sein Sensorium weniger ausgeprägt zu sein. Und was den Stellenwert des Romanfragments Andreas betrifft, so hat der Rezensent bei seiner Lektüre keine Klarheit gewonnen.
Die Diskretion Hofmannsthals kreist um zwei Stellen – Judentum und Homosexualität, neuralgische Punkte nicht nur dieser Biographie, sondern der Zeit, der Jahrhundertwende. Würde man das Buch Geschlecht und Charakter und die Lebensgeschichte seines Verfassers, Otto Weininger, parallel zu den Hofmannsthalschen Heimlichkeiten und Empfindsamkeiten lesen, käme man vermutlich auf einige Erklärungsansätze. Aber Erklärungen liegen, wie gesagt, nicht in Weinzierls Absicht. Statt eine Geschichte zu erzählen, häuft er Belege an, und zwar in möglichst großer Zahl. Um nur ein Beispiel zu nennen: Einer von Hofmannsthals Freunden, Eberhard von Bodenhausen, starb im Mai 1918, vermutlich durch Selbstmord. Die Angehörigen und literarischen Freunde versuchten, die Sterbensart zu vertuschen. Ihre Berichte sind laut Weinzierl „Friedhofskitsch“. Das hindert ihn nicht, solchen Kitsch in mehreren Varianten zu referieren. Man fragt sich, wozu – wo doch Bodenhausen nicht einmal Gegenstand des Buchs ist, sondern bloß eine Nebenfigur. Der Rezensent räumt ein, daß er derlei Anekdoten recht gern liest. Er macht aber auch darauf aufmerksam, daß es sich dabei um ein Darstellungsprinzip handelt, das in Klatschzeitungen üblich ist (wobei Weinzierls Niveau natürlich unvergleichlich viel höher ist).
Auch wenn Hofmannsthal kein praktizierender Homosexueller gewesen sein mag, so hatte er doch zumindest homoerotische Neigungen. Die meisten seiner Freundschaften sind homoerotisch unterspielt; Männer spielten in seinem Leben alles in allem eine viel größere Rolle als Frauen. Ebensowenig ist der jüdische Anteil an Hofmannsthals Herkunft wegzuleugnen – doch die verschämte Verschwiegenheit des Dichters in diesem Punkt dürfte den Spekulationen wie auch den antisemitisch bedingten Aversionen gegen ihn zusätzliche Nahrung gegeben haben. Daß die jüdische Problematik für Hofmannsthals Werk eine sehr große Rolle gespielt hat, möchte der Rezensent allerdings eher bezweifeln. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu hohen, sprich: adeligen Gesellschaftskreisen war mit Judentum und Homoerotik schwer vereinbar. Der Snobismus, das Streben nach einer Existenz als gentleman (ein in Hofmannsthals Umfeld und bei ihm selbst offenbar sehr beliebtes Wort), ist letztlich nichts anderes als der zeitgemäße Stil jener Verdrängung. Weinzierl zeigt uns, wie sich der Personalstil Hofmannsthals hier mit dem Epochenstil mischt. Und er weist darauf hin, daß die Perspektive vom Rand einer Gesellschaftsklasse, zu welcher der Autor gehören will, aber doch nicht ganz gehören kann, hervorragend geeignet ist, um literarische Werke hervorzubringen (immerhin, hier fällt doch einmal ein Licht von der Biographie auf das Schöpfertum). Weinzierl verweist auf Marcel Proust, der von einer ähnlichen Position aus tätig war: es ist die „Innensicht des Außenseiters, die erst jenes produktive Ineinander von Vertraut- und Fremdheit, von ersehnter Nähe und erzwungener Ferne ermöglicht.“
Das Verschweigen des Peinlichen schließt Empfindsamkeit nicht notwendig aus. Fast glaubt der Rezensent, aus Weinzierls Buch einen gegenteiligen Schluß ziehen zu können: Die notorische Distanziertheit und das Schwelgen in schönen zwischenmenschlichen Gefühlen sind zwei Seiten einer Medaille, beide Seiten bedingen einander und stärken gewissermaßen in dieser Janusköpfigkeit ihre Präsenz. Was bei Weinzierl als die dunkle, in das Gesamtbild schwer integrierbare Stelle erscheint, ist Hofmannsthals im Alter offenbar zunehmende Neigung, ihm nahestehende Personen, die er womöglich zu anderen Zeit betulich umsorgt hatte, vor den Kopf zu stoßen. Hofmannsthal entschuldigt sich in solchen Fällen regelmäßig mit seinem Nervenzustand. Kann es sein, daß nicht nur körperlich-seelische Dispositionen dabei eine Rolle spielten, sondern auch das Nachlassen der schöpferischen Kraft eines Autors, der einst wie eine Sternschnuppe – nennen wir sie Loris – als frühreifes Wunderkind aufgetreten war? Drückt sich darin eine heimliche Unzufriedenheit aus mit seinem Mangel an geistiger Selbständigkeit, mit seinem Angewiesensein auf Anregungen von außen, von Freunden wie Harry Graf Kessler, aber auch von Autoren der Literaturgeschichte, allen voran Goethe? Diese und andere Fragen versucht Weinzierl gar nicht zu beantworten, aber immerhin stellen sie sich im Verlauf seiner Arbeit und also der Lektüre des Buchs, dem man sicher nicht absprechen kann, daß es neben einer großen Materialfülle auch Anregungen für weiteres Nachdenken bietet.