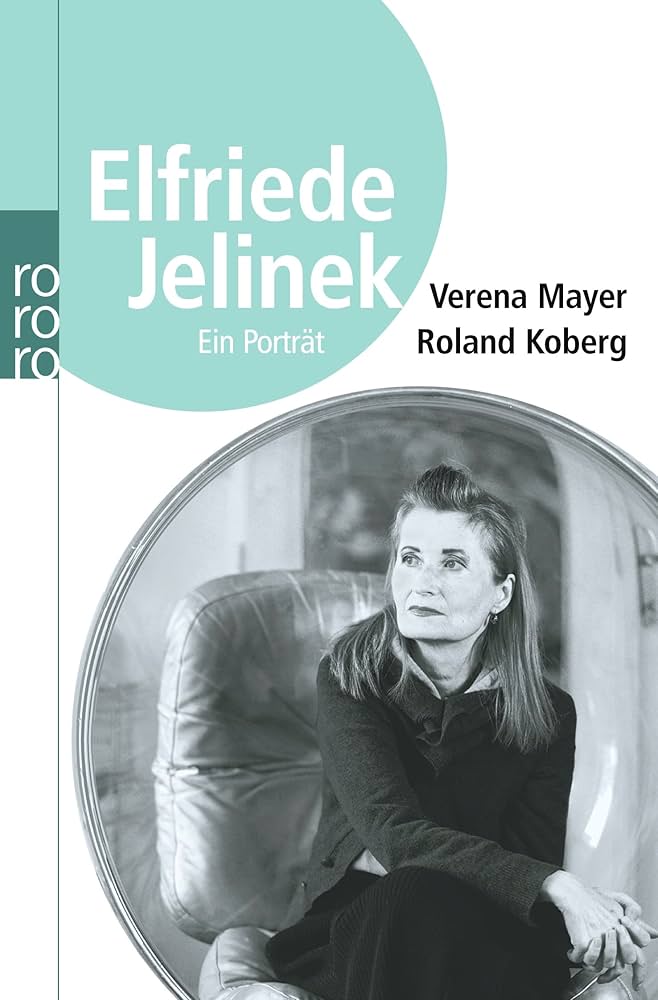Wie konsequent Elfriede Jelinek ihren künstlerischen Weg verfolgt hat und wie er im familiären Umfeld verortet werden kann, das haben nun erstmals die Journalistin Verena Mayer und Roland Koberg, seit 2001 Dramaturg am Deutschen Theater Berlin, in ihrem Buch „elfriede jelinek“ zu ergründen versucht. Der Untertitel Ein Porträt umreißt sehr gut, was zu finden ist und was nicht: Keine Biographie, die Intimitäten preisgibt und nach einer Wahrheit fahndet, die es nicht gibt, sondern eine behutsame Annäherung an die Korrespondenzen zwischen Leben und Werk.
Sehr diskret nähern sich Mayer und Koberg der Autorin, treffen sie in ihrem Haus in Wien, korrespondieren mit ihr per E-mail – eine Form der Kommunikation, die sie ebenso schätzt wie das Internet – und interviewen WegbegleiterInnen und Freunde, forschen in Archiven und lesen Interviews, Rezensionen, Analysen und ihr Werk. So ist es nur konsequent, dass in jedem der 14 Kapitel, die chronologisch das Leben Elfriede Jelineks begleiten, ihre Bücher und Theaterstücke im Mittelpunkt stehen und somit die Einheit von Werk- und Lebensgeschichte dokumentieren.
Es mag verwundern, dass auch bei einer Autorin, die so gar nicht vordergründig an ihrer Biographie entlang schreibt und die sich für alles, was in dieser Welt passiert, interessiert und es zu analysieren und zu erkennen sucht, indem sie es sprachlich bearbeitet, doch ein enger Zusammenhang zwischen eigener Lebens- und Familiengeschichte und literarischem Werk besteht. Aber dieses Buch macht auch klar, dass allzu schnelle Schlüsse zwischen Leben und Werk, wie sie vor allem von FeuilletonistInnen, LiteraturkritikerInnen und BoulevardjournalistInnen gleichermaßen gemacht werden, immer Kurzschlüsse bleiben.
Vorgesehen war – wie die AutorInnen darlegen – für das Wunderkind von der Mutter ja die Musikkarriere. Ein Klavier gab es in der Wiener Wohnung ebenso wie im hochgelegenen Sommerdomizil des großmütterlichen Gehöftes in der Steiermark. Die Tochter musste da wie dort üben, immer bei offenem Fenster. Der Konzertflügel von Steinway steht heute noch in ihrem Empfangszimmer des Hauses in Hütteldorf, in dem Elfriede Jelinek wohnt, bis zu deren Tod gemeinsam mit ihrer Mutter. Bereits mit 13 Jahren begann sie am Konservatorium ihr Orgelstudium, daneben lernte sie noch Bratsche, Violine, Gitarre und Blockflöte, besuchte das Gymnasium und studierte Komposition. Als sie jedoch 1971 ihr Orgelstudium mit „sehr gut“ abschloss, war das nur mehr eine Fleißaufgabe, denn bereits 1970 erschien ihr erster Roman „wir sind lockvögel, baby“ im renommierten Rowohlt Verlag und machte deutlich, dass sich die Tochter gegen die Musik und für die Literatur entschieden hatte. Auch im hohen Alter widmete sich die Mutter der Förderung ihrer Tochter, nur der Roman „Die Klavierspielerin“ gefiel ihr weniger. Aber das wurde durch den Erfolg der Tochter aufgewogen. Erst sehr spät, nämlich im „Sportstück“ und weiteren Theaterstücken, setzt sich Elfriede Jelinek mit der Geschichte ihres Vaters, der dement 1969 in Steinhof starb, auseinander. Aber es wäre zu einfach, eine Werkgeschichte auf eine Familiengeschichte zu reduzieren und das vermeiden die AutorInnen.
Mayer und Koberg zeichnen die Geschichte von Elfriede Jelineks literarischer Karriere nach, die von Anfang an erfolgreich war und von Distanz zur Öffentlichkeit und gleichzeitiger medialer Stilisierung bestimmt war. Sie gewann bereits anonym 1969 bei den Innsbrucker Jugendkulturwochen die Preise für Lyrik und Prosa, später viele wichtige Preise (u.a. Büchner-Preis, Lessing-Preis, Heine-Preis, Kafka-Preis) und als Krönung den Nobelpreis. Deutlich wird, dass Elfriede Jelinek ihre literarischen Verfahrensweisen weiter differenziert und die Auseinandersetzung mit den neuen Medien intensiviert hat, weil sie nach wie vor an Roland Barthes‘ Konzept glaubt, gegen den schönen Schein zu schreiben.
Am Ende ihrer Annäherung resümieren die AutorInnen über die Aufzeichnung ihrer Nobelpreisrede, die ihnen exemplarisch für Jelineks Autorinnenposition erscheint: „Für Elfriede Jelinek ist Sprache nicht zuletzt das Instrument, das ihr alle anderen Instrumente ersetzt hat. Die Zuschauer blickten auf eine Leinwand, während sie sprach. An ihrem Notenständer war sie allein und ganz bei sich, aber sie wusste um ihre Wirkung und war zu hören, so wie einst als Klavierspielerin bei offenen Fenstern.“
Ein besonderer Verdienst dieses Jelinek-Porträts von Verena Mayer und Roland Koberg ist die präzise Nachzeichnung einer Lebens- und Werkgeschichte ohne voyeuristische Seitenblicke und ohne psychologische Erklärungsmuster des künstlerischen Werkes durch biographische Fakten.