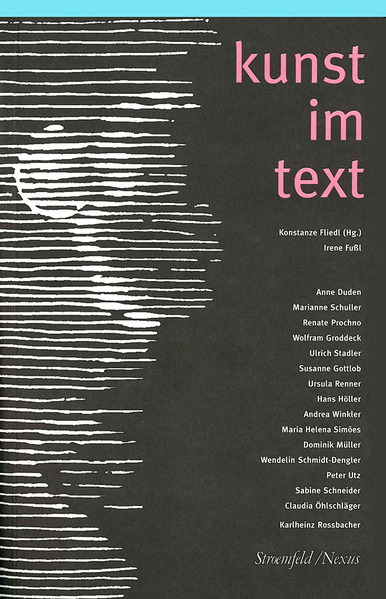Dieses Verhältnis hat auf das Buch selbst eingewirkt: Es ist ein liebevoller Band geworden. Das Buch beginnt mit einem schon an anderer Stelle veröffentlichten Beitrag von Anne Duden zu Paul Cézannes Bild Madame Cézanne auf gelbem Lehnstuhl. Die Autorin, deren Bezugnahme auf zwei Bilder Francis Bacons später selbst Thema des Beitrages von Sabine Schneider wird, vermag, ihrer präzisen Beobachtungsgabe auch präzise, poetische Worte zu geben. Auch wenn dies nicht leicht zugänglich sein mag – und das gilt für die meisten Beiträge des Buches -, so ist es doch Blicke öffnend, was hier zu lesen ist.
Die weiteren 16 Beiträge konzentrieren sich einerseits auf Text-Bild-Relationen innerhalb eines Werkes (etwa Claudia Öhlschläger, die W. G. Sebalds Texte untersucht, in denen immer auch Gemälde – im vorliegenden Beitrag geht es vor allem um jene Matthias Grünewalds – und Fotos abgebildet sind), andererseits auf ‚Doppelbegabungen‘ (etwa Susanne Gottlob, die den Bezug des schreibenden und malenden Pierre Klossowski auf Ingres thematisiert, oder Hans Höller, der den malenden und schreibenden Peter Weiss ins Zentrum rückt), und wiederum andere kommen auf reale Kontakte zwischen Personen zu sprechen (etwa Marianne Schuller zur Beziehung zwischen Franz Marc und Else Lasker-Schüler oder Ulrich Stadler zu jener zwischen Kurt Tucholsky und John Heartfield); die einen schildern im Detail biographische Hintergründe (etwa Renate Prochno zu Lion Feuchtwangers Goya-Roman oder Karlheinz Rossbacher zu Gemälden Fernand Khnopffs und Gedichten Christina Rosettis) oder die Rezeptionsgeschichte von bestimmten Werken, während sich andere hingegen einem textimmanenten Blick widmen (etwa Wolfram Groddeck zu Robert Walsers „Sonett auf eine Venus von Tizian“, Wendelin Schmidt-Dengler zu Thomas Bernhards Auffassung von Kunst in „Frost“ und – vor allem anhand eines Tintoretto-Gemäldes – in „Alte Meister“ oder auch Peter Utz zur Thematisierung eines Breughel-Gemäldes bei Gert Hofmann, wo es um das Thema „Blindheit“ geht).
Wie die Beiträge im einzelnen stringente und konzise Einblicke in ihre Themen geben – natürlich sind einige spannender und flüssiger zu lesen als andere (wohl das ‚Schicksal‘ nahezu jeden Sammelbandes) -, so bietet auch der Band als Ganzes trotz der Vielfältigkeit einen kohärenten Überblick über die Möglichkeiten der Beziehung zwischen Kunst und Text, wobei es dabei ausschließlich um Werke männlicher Maler geht. (Man könnte dem noch hinzufügen, dass es in vier der ersten sechs Beiträge um weibliche Akte geht – ein Schelm, wer …)
Durch den engen Kontakt, der hier insgesamt zwischen literarischen Texten und Werken der bildenden Kunst geknüpft wird, schimmert ein im 20. Jahrhundert fast völlig verschüttetes Verständnis von Zeichen durch: Sie sind nicht nur – arbiträre und abstrakte – Symbole, sondern auch Bilder mit ikonischer Kraft. Deutlich wird dies bereits im zweiten Beitrag, wenn Else Lasker-Schüler sagt: „Jedem Buchstaben malte ich ein Tuch um den Hals, da er fror, es war Winter.“ (S. 15) Bilder und Texte werden so zu „Malen“, die am Körper hervortreten (Schuller Walter Benjamins Aufsatz „Über die Malerei oder Zeichen und Mal“ anführend, S. 28). Diese Thematik zieht sich durch das ganze Buch, und zwar in mehreren Facetten: Kunst und Literatur sind Umdichtungen – „Goya malt, Feuchtwanger schreibt. Beide dichten etwas um, was sie vorfinden“ (S. 34) – und erhalten so performative Kraft, eine Kraft, die in der Kulturtheorie seit gut 40 Jahren thematisiert und in diesem Buch anschaulich vor Augen geführt wird. Sprache wird so verleiblicht und zu einem „Sprachkörper“ (Schneider, Anne Duden zitierend, S. 238), in dem wiederum Erinnerungsspuren lesbar sind. Rossbacher stellt dann auch ein Deleuze-Zitat als Motto seinem Beitrag voran: „Daß die Körper sprechen, auch das wissen wir seit langem.“
Die in der Gegenwart weit gängigere Sprachauffassung – Sprache als Zeichen für etwas – wird jedoch keineswegs über Bord geworfen, sondern geschickt in das Feld der Malerei übertragen, wenn etwa Höller gekonnt zeigt, wie Weiss in der „Ästhetik des Widerstands“ (es geht dort um Picassos „Guernica“) „die gestisch deiktische Funktion der Bilder und die Sprachähnlichkeit der visuellen Zeichen betont“ (S. 137).
Es verwundert insgesamt daher nicht, dass die zahlreichen mehr oder weniger deutlich artikulierten Bezugnahmen auf Lessings scharfe Grenzziehung zwischen der Literatur (in der Zeit) und der Malerei (im Raum) zurückgewiesen oder zumindest in Zweifel gezogen wird. Texte (wie eben beispielsweise jene von Anne Duden, S. 241) verweigern sich in vielen Fällen einem linearen Erzählmuster – und die Auseinandersetzung der Schriftsteller/innen über bildende Kunst ist immer „ein Nachdenken über die möglichen Grenzerweiterungen der Sprache“ (S. 246). Am besten fasst es Konstanze Fliedl im Nachwort zusammen: „So können Bilder als Schriften gelesen, aber auch Schriften als Bilder gesehen werden.“ (S. 305)
Der Band bietet neben bekannten Werken auch Zugang zu Marginalien der Kunst- und Literaturgeschichte: Walsers Tizian-Gedicht wurde bislang nur in einem Aufsatz behandelt (S. 63), und auch die Texte von Kurt Tucholsky „Hinter der Venus von Milo“ (S. 79ff.) oder Hans Maagnus Enzensbergers Gedichte auf Gemälde (im Beitrag von Maria Helena Simões) sind bislang wenig beachtet worden, wobei allerdings nicht immer klar wird, warum gerade diese Werke zur Sprache gebracht werden. (Ein möglicher Weg der Begründung das Marginale gegen die Tradition zu richten – wird auf jeden Fall nicht beschritten.)
Dem Rezensenten fehlt die kunsthistorische und bei einigen Texten, die hier Thema sind, auch die literaturwissenschaftliche Basis zur Beantwortung der Frage, ob das hier Präsentierte auch hieb- und stichfest ist. Dass es aber Hand und Fuß hat und auch präzise, stimmig und liebevoll beschrieben ist, sieht man allen Beiträgen an. Nur sehr selten stutzt man ein wenig beim Lesen, wenn etwa nicht klar wird, warum Rossbacher seinen Beitrag mit Botho Strauß beginnt, oder wenn Andrea Winkler, wenn sie den Spuren des Picasso-Bildes „Paul beim Zeichnen“ bei Friederike Mayröcker nachgeht, Theoriemuster auf das Bild zu übertragen scheint, ohne dieses selbst so recht wahrzunehmen: Es mag nicht recht einleuchten, von einem gegenständlichen Bild (von dem jede/r sehen kann, was es darstellt) zu sagen, es „verweigert jeglichen Realismus“ (S. 150). Das alles fällt aber nicht ins Gewicht; was aber nun wirklich ein bisschen schade ist – gerade für einen solchen Band – ist die Tatsache, dass die Gemälde so klein und meist schwarz-weiß abgebildet sind.