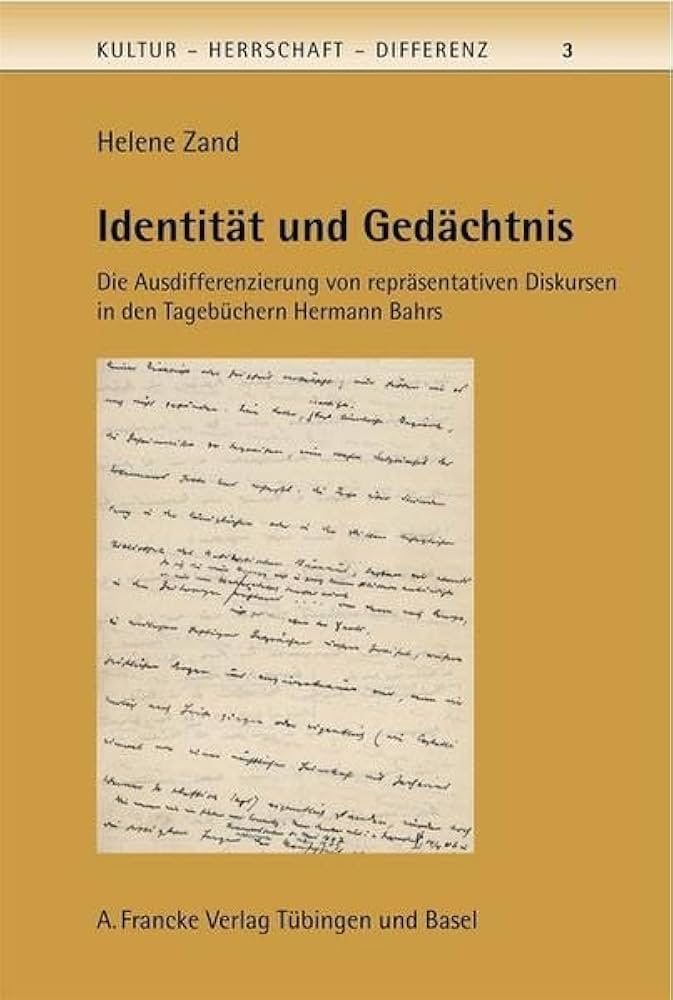Es gibt einen Seitenzweig der Kriminologie, die Victimologie, die nach dem Anteil des Opfers einer Untat fragt. Von ihrem Standpunkt aus gesehen, hat Hermann Bahr tatsächlich einen hohen Anteil an der Demontage seiner Reputation durch Kraus. Doch es gibt mehrere Bahrs: den lächerlichen Autor des offenen Briefes an Hugo von Hofmannsthal und anderer journalistischer Unerträglichkeiten, den Verfasser heute weitgehend vergessener Theaterstücke und Romane – und einen erstaunlich sensiblen, gut orientierten Theoretiker der Moderne in ihrer nicht nur österreichischen Ausprägung. Bahr 1 und Bahr 2 haben – im Verein mit Karl Kraus – jahrzehntelang die Forschung behindert, ja vielleicht sogar verunmöglicht. Seit den (mittlerweile zwei) Büchern Donald Daviaus, den Arbeiten des Reinhard Farkas und anderer gibt es ein wachsendes Interesse an Hermann Bahr und seit 1994 erscheinen unter der Ägide von Moritz Csáky die Tagebücher Bahrs in bisher fünf Bänden, deren erste vier unter anderem den Zeitraum von Bahrs Pariser Aufenthalt über die unterschätzte Zeit in Athen bis zur Begegnung mit Anna Mildenburg umfassen.
Die Bearbeiter der ersten vier Bände wechseln, konstant unter ihnen ist Helene Zand, die jetzt eine kulturwissenschaftliche Monographie über die Tagebücher unter dem nicht nur für die letzte Jahrhundertwende so zentralen Aspekt der Konstituierung von Identität und Gedächtnis vorlegt. Sowohl der Quellenwert wie auch der Eigenwert von Bahrs Tagebüchern ist unbestreitbar, doch wer je einen Blick in sie geworfen hat, weiß um die Sprödheit dieser Lektüre. Der Text ist häufig relativ zusammenhangslos, bloße Ansammlungen von Daten, Wetterberichte gar oder das Vermerken von tatsächlichen oder gescheiterten Verabredungen wechseln mit Zitaten, Berichten, Einfällen, literarischen Entwürfen, persönlichen und allgemeinen Reflexionen von gelegentlich bilanzierendem Charakter. Eine Arbeit „über“ Bahrs Tagebücher wirft das Problem auf, dass der sprunghafte Autor, wie er selbst einräumt, „niemals verharrte“.
Gerade darin liegt für Helene Zand der zentrale Ansatzpunkt ihrer Interpretation. „Das Ich“, heißt es in einem Aufsatz Bahrs, sei „immer schon Konstruktion, willkürliche Anordnung, Umdeutung und Zurichtung der Wahrheit, die in jedem Augenblick anders gerät.“ Und genau diesen Prozeduren ist die Autorin mit einer erstaunlichen Präzision auf die Spur gekommen. Wenn – so eine These Jacques LeRiders – das Wien der letzten Jahrhundertwende die Postmoderne antizipiert hat, dann ist die Flexibilität, die Bahr in seinen Tagebüchern praktizierte und auch immer wieder von sich selbst einforderte, mit dem Instrumentarium, das Zand anwendet exakt erfassbar. Hinter den scheinbar wirren und zusammenhanglosen Notaten verbirgt sich – wenn man den von Helene Zand angelegten Registern der Funktion der jeweiligen Eintragungen folgt – eine Konzeption, die gerade ihre eigene Zusammenhanglosigkeit als bestimmendes Element thematisiert. Dass die Zandsche Lesart nicht willkürlich ist, sondern durchaus im Sinne Bahrs liegt, zeigt ein Notat aus den späteren Tagebüchern, das belegt, dass Bahr eine Publikation in Erwägung zog – und zwar nicht für die Nach- sondern für die Mitwelt. Bahrs Tagebuch versteht sich also selbst als ein kulturhistorisches Dokument, es ist außenorientiert und damit auch zensuriert – der biographische Quellenwert ist geringer als der kulturhistorische.
Generell kann man ja davon ausgehen, dass die Textsorte Tagebuch zur Analyse des Zusammenhangs von Identität und Gedächtnis besonders einlädt – das gedächtnisstützende Tagebuch, so Manfred Jurgensen, ermöglicht „die Konstitution eines Ichs“. Für Zand ist der Modus der Konstituierung von Identität und Gedächtnis, den Bahr in seinen Tagebüchern unternommen hat, durchaus modellhaft für die krisengeladene Zeit der letzten Jahrhundertwende. Der frühe Bahr, ein klassischer „moderner“ Rebell gegen die Werte der Vätergeneration, war sich gleichzeitig der Kosten und des Enttäuschungspotentials der Modernisierung bewusst. Dass Bahr sozusagen international dachte und gleichzeitig eine Konzeption einer österreichischen Identität entwickelte, kann als Versuch einer Entschärfung der „Negativdimensionen der Moderne“ verstanden werden. Obwohl also der biographische Quellenwert nicht allzu hoch zu veranschlagen ist, gewinnt Bahr in dieser Arbeit neue Konturen – und man versteht auch, jenseits der von Kraus zentrierten Torheiten Bahrs, warum der Satiriker in diesem einen Antipoden sah. Kraus, beispielsweise, arbeitete an einem neuen Verständnis der deutschen Sprache (oder an einer Neubelebung eines durch den Journalismus zerstörten traditionellen Verständnisses) – Bahr hingegen war in endlose Projekte des Erlernens fremder Sprachen inklusive dem Auswendiglernen von Textpassagen verstrickt. Und das hatte für den Puristen der deutschen Sprache Kraus wohl den Charakter von Oberflächlichkeit und Verrat.