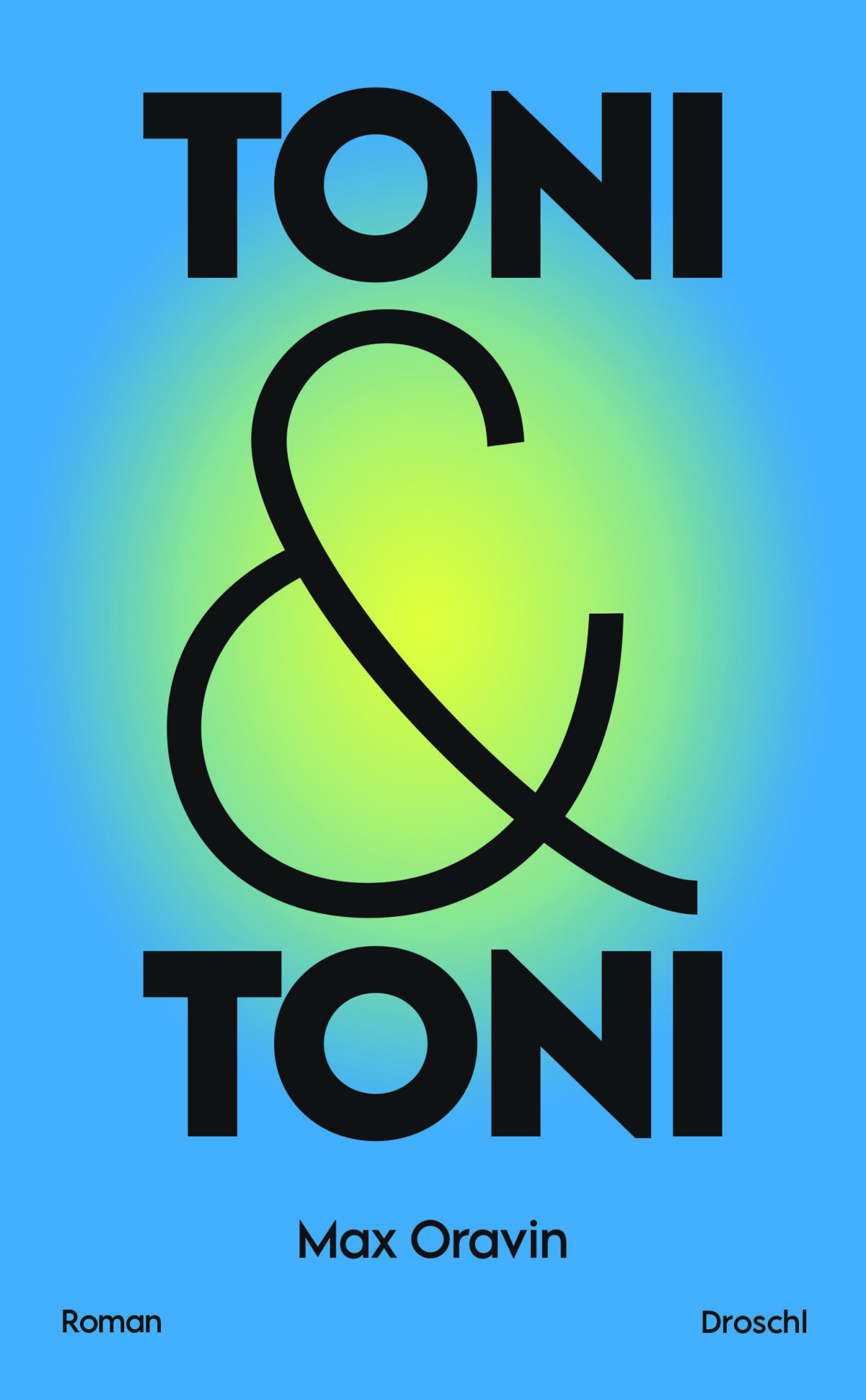„Weiß ist die Zeit, die nicht vergeht, schwarz der Wortstrom, auf den mein Denken schaut. Es ist schon lange nichts passiert“ (S. 8), sinniert der Erzähler Toni auf seinem Heimweg von der Nationalbibliothek, wo er sich täglich viele Stunden lang in das Studium japanischer Kanji vertieft. Nach dem spaced repetition system übt er zunächst die dreihundert Schriftzeichen, die für den jeweiligen Tag anstehen, dann die fünfundzwanzig neuen, deren Bedeutung er erst lernen muss. Alles nach einer mnemonischen Methode, mit kleinen Geschichten, die die Bedeutung jedes Zeichens aus seinen Bestandteilen entziffern. Wer den Buddhismus studieren wolle, müsse Japanisch lernen, hat er drei Monate zuvor gehört und am selben Tag damit begonnen. Nach sieben, acht Monaten will er die Bedeutung der zweitausend wichtigsten Kanji kennen, nach zwei, drei Jahren sechstausend.
„Es ist leicht, einem strengen Plan zu folgen, viel schwerer, planlos das Versäumte aufzuholen.“ (S. 94) – an diese Wahrheit klammert sich Toni, der das Leben nie so richtig zu fassen bekommt, mit einer Intensität, die keine Abweichung erlaubt. Ein morgendlicher Gang zum AMS, wo der studierte Philosoph mangels Jobangeboten zu einer Schulung eingeteilt wird, löst ein Flashback bei ihm aus:
„Fettgedruckt der Ort, der Anna-Altmann-Park, er ist mir bekannt, ich halte inne, die Füße stockend am Asphalt, sehe die flüchtig gebauten Mauern inmitten des Parks aufragen, sehe mich, damals, das Gebäude betreten und durch die vertrauten Gänge gehen, ich atme ein, atme aus, öffne die Tür, lasse das Licht in die Hirnkammern brechen, Fühlen Fühlen Fühlen 感感感. Doch diesmal entkomme ich dem Lichtstrom, bleibe bei mir. Schritt vor Schritt vor Schritt zu setzen, bis nichts mehr bleibt als Schreiten, ein Kinhin 経行 [Kinhin bedeutet im Zen-Buddhismus die Meditation im Gehen oder das Gehen in Achtsamkeit und Bewusstheit] des Gehirns.“ (S. 12)
Bodies That Matter hieß das Tanzstudio in ebendiesem Park neben den AMS-Kursräumen, in dem Toni & Toni auf einer anderen Zeitebene, in einem anderen Leben ihre Performance einstudierten, und nun soll er dorthin zurückkehren, anstatt wie gewohnt seinen festen Platz im Lesesaal der Nationalbibliothek einzunehmen, wo die „massiven Mauern“ ihn schützend einengen, „die Gesten komprimieren“, das Denken zwingen, „sich in klar gesetzten Grenzen zu artikulieren“ (S. 16). Tonis Unruhe erhöht seine Fehlerrate beim Lernen, kratzt an seinem Zeitplan, lässt ihn erst abschweifen zur Betrachtung buddhistischer Sutren, dann zu Toni, die vielleicht aufgestanden ist, vielleicht noch schläft, zu ihren Lieblingsserien, die vom Tanz handeln, zu ihren klaren präzisen Gesten, die nun beschnitten sind wie die Bewegungen eines Wildtiers im Käfig.
„kein Fühlen kein Wahrnehmen kein Wollen kein Denken kein Auge kein Ohr keine Nase keine Zunge kein Körper kein Geist keine Farbe kein Ton kein Geruch kein Geschmack keine Berührung kein Ding.“ (S. 19)
So die Worte aus dem buddhistischen Herzsutra, die den Erzähler nie verlassen. Ein Rhythmus der Verneinung mit zwei unterschiedlichen Zeichen für „nicht“, deren genaue Bedeutung Toni noch nicht erfassen kann. Eine Leere, die sich auf die Modi der Zeit, auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erstreckt und einen wohltuenden Gegenpol bildet zur „Hirnflut“, die „Lichtbild um Lichtbild“ an die Innenseite von Tonis Stirn wirft (S. 22).
Die Kanji der Verneinung aus dem Herzsutra durchziehen diesen ganzen Roman. Toni & Toni spiegeln einander als Figuren, sie sind eins und – jeweils auf ihre eigene Art – nicht lebensfähig, nicht gesund: „Langsam sehe ich, wie uns der gemeinsame Alltag entgleitet, wie ich, für mich, nach außen trete, und Toni sich faltet ins Innerste unserer Wohnung.“ (S. 79)
Der Erzähler ist regelrecht besessen vom Entziffern seiner Schriften und er begreift auch die Schnitte, mit denen die Haut seiner Partnerin übersät ist, als Schriftzeichen. Gleichzeitig sehnt er sich danach, aus der Sprache auszubrechen, er sehnt sich nach der Zeichenlosigkeit als Tor zur Freiheit, nach dem reinen, „blankpolierten Sein“ (S. 95).
Wollte man Max Oravins Roman auf seine Story reduzieren, bliebe ein bedrückendes Protokoll des Scheiterns und des Schmerzes, doch das wäre mehrfach zu kurz gegriffen, denn die eigentlichen Protagonisten sind die Sprache, das Denken und die Zeit. Und – vielleicht am allerwichtigsten – der Sound. Toni & Toni ist wie eine Performance gestaltet – als poetischer Wortstrom mit repetitiven Elementen, rhythmisch motivierter Zeichensetzung und flackernden Bildern.
Dass in diesem Buchdebüt einige sprachliche Ungenauigkeiten stehen geblieben sind, ist schade, aber in Relation zum höchst komplexen und gelungenen Ganzen verschmerzbar. Max, der Schriftsteller und Max, der Sound Artist arbeiten hervorragend zusammen und es ist ein starkes Signal, dass dieser interdisziplinäre Text für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert wurde.
Sabine Schuster, Germanistin, DaF-DaZ-Trainerin, langjährige Redakteurin des Online-Buchmagazins im Literaturhaus Wien.