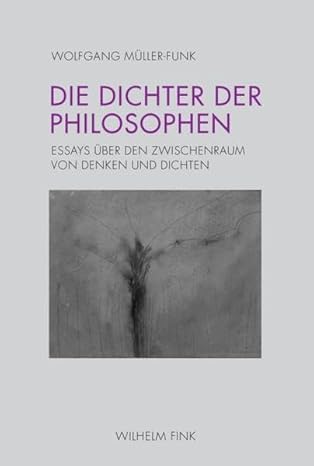Die knappe und informative Einleitung macht klar, worum es geht: Das Buch – das im Übrigen auf eine Vorlesung des Autors an der Universität Wien zurückgeht, wodurch erstens jene Kontingenz gesichert ist, die Sammelbände ähnlichen Zuschnitts leider manchmal vermissen lassen, zweitens auch das Übergewicht an deutschsprachigen Autoren (was nicht verschwiegen wird) erklärbar ist – »bewegt sich in dem durch die Doppeldeutigkeit des Titels umrissenen Denkraum. Es interessiert sich für PhilosophInnen, für die die Beschäftigung mit Dichtung, mit einem oder auch mehreren Dichtern von zentraler Bedeutung ist. Zentrale Bedeutung meint, dass diese Auseinandersetzung mit einem Autor, mit einem Werk, mit Fragen der Dichtung für die Entwicklung ihres eigenen Denkens konstitutiv ist, dass ihr philosophisches Werk ohne diese ästhetische Erfahrung nicht denkbar wäre, dass es zumindest eine andere Wendung genommen hätte, dass diese eine Bedingung der Möglichkeit ihres Denkens darstellt.« (S. 8)
Ohne Dichter keine Denker also – das hört man als Literaturwissenschaftler natürlich gerne, umso mehr als die Schar der Philosophen, die Müller-Funk auf den Laufsteg lässt, beileibe keine randständigen Vertreter ihrer Zunft sind: Heidegger, Adorno, Schelling, Hegel, Barthes, Kofman, Benjamin, Lyotard, Arendt, Waldenfels, Lévinas, Kierkegaard und Anders. (Dass zwei Frauen und auch nicht nur kanonisierte Philosophen darunter sind, ist erfreulich; Grenzfälle – Freud und Cassirer – und der Dichtung gegenüber Gleichgültige – Wittgenstein hätte der Rezensent hierbei allerdings nicht unbedingt angeführt – nennt der Autor in der Einleitung.) Aber auch die Dichter dieser PhilosophInnen sind keine Unbekannten der Weltliteratur: Goethe, Hölderlin, Eichendorff, Diderot, Cervantes, Mozart/Daponte, E. T. A. Hoffmann, Kafka, Musil und Celan.
Müller-Funk erläutert in der Einleitung also erstens und erfreulich genau die Gründe für seine Wahl und vermag damit Vorwürfe konzise zu entkräften, bevor diese ausgesprochen sind: Was hat es mit der Rhetorizität von Philosophie ganz allgemein auf sich (Stichwort: Paul de Man)? Was ist mit den Philosophen, die sich teilweise eines »literarischen Stils« befleißigen (Stichwort: Jacques Derrida)? Wo bleiben die »Doppelexistenzen«, die Philosophen und Schriftsteller sind (Stichwort: Peter Bieri/Pascal Mercier)? Und warum keine Romane, die »philosophisch« sind (Sofies Welt, Candide und andere)? Die Vorwürfe, die die LiteratInnen den PhilosophInnen und umgekehrt zu machen pflegten und immer noch pflegen, spart Müller-Funk nicht aus.
Ebenso erläutert werden zweitens die Gründe für die Wahl des Generalthemas der Essays: Das Verhältnis zwischen Dichtung und Philosophie beschäftigt das Denken zumindest seit Platons Politeia, und es ist immer noch aktuell, weil es im Kern die Frage der Wahrheit und Wahrheitsfähigkeit der Sprache betrifft. Dass die Grenze zwischen wahr und falsch nicht mit der zwischen faktisch und fiktiv/fiktional zusammenfällt, ist bereits in der Poetik des Aristoteles (die hätte man sich als Gegenspieler zu Platon in die Einleitung gewünscht) ein zentraler Gedanke; und da Sprache die Welt nicht einfach zur Abbildung bringt, sondern diese in Form sozial verhandelbarer Wirklichkeit vielmehr erst hervorbringt, ist die Frage des Verhältnisses zwischen Faktischem und Fiktivem/Fiktionalem auch heute wichtig, ja wichtiger denn je: Leben wir doch in einer Welt, die mehr denn je der kommunikativen Vermittlung bedarf, da wir von dem, was auf der anderen Seite der Welt passiert, unmittelbar betroffen sind, gleichwohl aber nicht dort sind, also keine direkten Erfahrungen damit machen können. Konsequent ist daher auch der methodische Ansatz in den Essays, der sich nicht »einer linearen Wirkungsgeschichte« verpflichtet fühlt, sondern »die Methode der Intertextualität« zur Anwendung bringt, die davon ausgeht, dass »der Textbezug stets beide Texte [verändert]« (S. 11). Dass sich Müller-Funk auch dekonstruktiver Interpretationstechniken zu bedienen weiß, zeigt sich immer wieder in den jeweiligen Texten und passt auch hervorragend zu dieser essayistischen Form der Beschäftigung mit dem Zwischenraum zwischen Philosophie und Literatur.
Und drittens wird auch verdeutlicht, was PhilosophInnen ganz generell an der Dichtung fasziniert haben mag: »Zunächst ist es die Lust auf eine Sprache, die Plastizität, Anschaulichkeit und lebensweltliche Bezüge ermöglicht – die dichterische Sprache als Preis für den Preis der Abstraktion. Dazu gesellt sich der Wunsch nach einem dichterischen Habitus des Philosophen. Aber es existiert auch Bedarf nach Themen, die in der Dichtung, nicht aber im regulären Diskurs der Philosophie und der Wissenschaften zur Sprache kommen, einfach weil deren Diskursregeln zu strikt und zu rigide gezogen sind. […] Und schließlich gibt es, oft uneingestanden, eine Suche nach neuen Darstellungsformen des Denkens […]. Dort, wo Philosophie an ihre Grenze stößt, wird die Begegnung mit ihrem anderen, der Sprache von Dichtung und Literatur attraktiv.« (S. 8f.) Dass wir es also mit Übersetzungsprozessen zu tun haben, ist dem Autor klar, ebenso, dass es einen Unterschied gibt »zwischen philologischem und philosophischem Lesen von Literatur« (S. 10).
Auch wenn Müller-Funk jeweils die Beziehung zwischen zwei Personen in den Mittelpunkt rückt (Heidegger/Hölderlin, Adorno/Eichendorff, Schelling/Cervantes, Barthes/Goethe etc.) – wobei es in erster Linie um eine Erläuterung der PhilosophInnen und Philosophien durch die Dichter (und nicht umgekehrt) geht -, so macht er doch immer wieder deutlich, dass es im Leben der behandelten PhilosophInnen doch immer mehr als ein dichterisches – bzw. ganz allgemein künstlerisches – Gegenüber gegeben hat. Heidegger ist ja ohne van Goghs Schuhe (S. 13), Conrad Ferdinand Meyers Der römische Brunnen (S. 15), Rilke, Trakl oder George (S. 16) ebenso wenig zu denken wie Adorno ohne Kafka, Proust oder Beckett (S. 37) oder auch Roland Barthes ohne Musil, Stendhal, Bataille oder Baudelaire (S. 101). Einige Essays erläutern Positionen eines Philosophen in seinem Bezug zur Dichtung ganz allgemein (wie etwa der Beitrag zu Heidegger), andere suchen stärker den Zugang zu einem bestimmten Text des zur Debatte stehenden Philosophen (etwa der Beitrag zu Roland Barthes, der sich dessen Fragmente einer Sprache der Liebe widmet), und wiederum andere rücken einen Schriftsteller oder literarischen Stoff in den Vordergrund, an dem sich mehrere PhilosophInnen abarbeiten (etwa der Beitrag zu Franz Kafka oder jener zum Don Juan-Stoff, mit dem sich Kierkegaard, Kristeva oder Bloch auseinandersetzten).
Einige Beiträge widmen sich Beziehungen, die der Forschung vermeintlich keine neuen Aspekte mehr bieten können (Müller-Funk beweist fast beiläufig und dadurch wohltuend das Gegenteil), etwa Heideggers Bezugnahme auf Hölderlin, andere bieten Einblick in weniger bekannte Gefilde, z. B. in Schellings Cervantes-Lektüren oder in Kofmans Dialog mit E. T. A. Hoffmann, der im Übrigen – wie Müller-Funk festhält, »unbestreitbar ein Dichter der Philosophen« ist (S. 123), also wohl alleine Stoff für ein Dutzend Essays liefern würde. Ähnliches gilt auch für Kafka, »dessen ästhetisch-reflexives Potential […] unerschöpflich [erscheint], von der Religionsphilosophie bis zu Deleuze und Guattari, von Walter Benjamin über Günter Anders und Hannah Arendt bis zu Jean-François Lyotard, dem Erfinder der Formel von der Postmoderne« (S. 133).
Die Beiträge sind durchwegs luzide, präzise argumentiert und stilistisch elegant formuliert, und sie liefern der philosophischen und der literaturwissenschaftlichen Diskussion neue Facetten und Aspekte. Dass sie wissenschaftlichen Beiträgen weit stärker gleichen als Essays, tut weder dem Erkenntniszuwachs noch dem Vergnügen beim Lesen Abbruch. Es fällt schwer, die Beiträge im einzelnen hier vorzustellen, zu dicht gewoben, zu informativ und zu genau formuliert und argumentiert sind sie für eine Rezension. Jeder einzelne Essay hätte eine eigenständige Würdigung verdient, zumal Müller-Funk es meisterhaft versteht, in wenigen Sätzen komplexe Theorien und Positionen aufzurufen, die sofort zum Weiterdenken animieren und Stoff bieten würden für ganze Debatten. Alleine, wie er Heideggers Denken über die Dichtung auf wenigen Seiten schildert und dieses in den Gesamtzusammenhang von nationalsozialistischer Ideologie ebenso einzurücken vermag wie in die Exegese des Höderlinschen Werkes oder in Adornos gegen Heidegger gerichtete Hölderlin-Interpretation, verdient höchsten Respekt. Ebenso meisterhaft versteht es Müller-Funk, die 11 Essays als eigenständige und für sich lesbare Texte zu präsentieren und sie doch immer wieder argumentativ zu verknüpfen: So zieht sich ein roter Faden, der durch >personelle und thematische Überlappungen< zwischen des Essays explizit gemacht wird, von »Theorien, in denen Kunst und Literatur eine Schlüsselrolle einnimmt – etwa die These Heideggers, dass die Dichtung ein privilegiertes Verhältnis zum Seienden unterhält, […] Adornos Annahme, dass nur in der Anschaulichkeit der Kunst sich das Wahre, und damit das Unwahre der Gesellschaft zeigt […] oder Schellings Philosophie der Kunst, die […] von der prinzipiellen Überlegenheit der Kunst gegenüber der Philosophie aus[geht]« (S. 48) – über Hegel, für den »die Kunst keinen philosophischen Ernstfall darstellt« (S. 61) und trotzdem »einer verschämten Lektüre […] Diderots Jacques le Fataliste [verdankt]« (S. 67), bis zu Positionen, die, so resümiert Müller-Funk die Ansicht von Hannah Arendt über Kafka und Broch, »das Entweder-Oder der modernen Literatur überwunden [haben]: dass nämlich Dichtung (wieder) fähig sei, entweder zum Mythos und damit zum Medium der Wiederverzauberung der Welt zu werden oder ansonsten im Sinne der Hegel’schen Figur des Verschwindens – als unmöglich gewordene Form der Repräsentation von Wahrheit – zugrunde zu gehen« (S. 165).
Wolfgang Müller-Funk fächert mit den elf Essays ein beeindruckendes, vielfältiges und detailreiches Panorama auf, das an eine Fotografie von Gursky denken lässt, die man umgehend an die Wand hängen möchte und an der man sich nicht sattsehen kann.