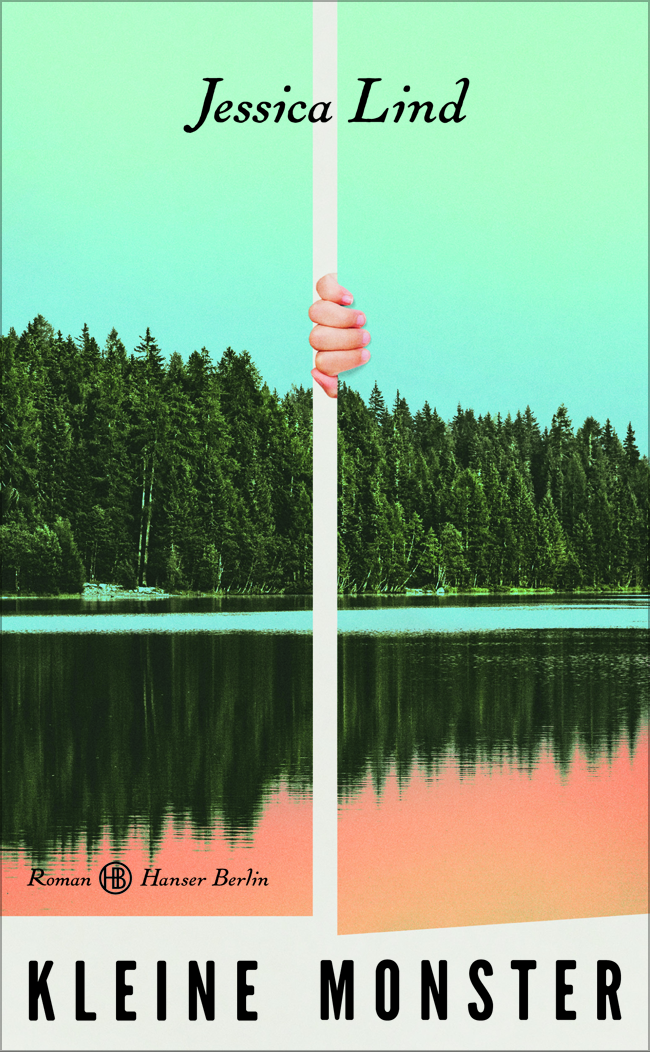Pia, Jakob und ihr siebenjähriger Sohn Leon entsprechen dem Ideal einer modernen, liebevollen Kleinfamilie. Sie wohnen in Pias Heimatstadt St. Pölten, mit einem unterstützenden Großelternpaar in der Nähe. Die Handlung setzt ein, als Pia und Jakob in die Schule zitiert werden, da Leon von einer Klassenkollegin ein sexueller Übergriff vorgeworfen wird. Während Pia ihren Sohn nach außen hin verteidigt, setzt sich in ihrem Inneren ein Prozess des Misstrauens in Gang: Was denken und reden die anderen Eltern, die sie sogleich aus der Eltern-Chat-Gruppe entfernt haben, über sie? Macht Leon nach dem Vorfall tatsächlich ins Bett oder verschüttet er nur Wasser, damit es den Anschein hat? Ist Jakob wirklich so gutgläubig, wie er tut, oder plant er schon heimlich, Pia zu verlassen?
Der Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und die Entfremdung gerade von den ihr nahestehenden Personen hat seinen Ursprung in einem Kindheitstrauma, von dem wir als Leser:innen sukzessive mehr erfahren. Pia war die älteste von drei Schwestern. Romi wurde von den Eltern adoptiert und war fast gleich alt, Linda war die jüngste.
Im 4. von insgesamt 22 Kapiteln befinden wir uns erstmals in Pias Kindheit. Wir sind mit ihr und ihren beiden Schwestern während eines Gewitters im Wald: „Und ich sage, du musst keine Angst haben, hier passiert uns nichts, und sie sagt, ich weiß. Und Romi fragt, warum, und Linda sagt: »Wir drei sind eins.«“
Dieses Bild der Zusammengehörigkeit wird im weiteren Verlauf auf verschiedenste Arten zerstört, am offensichtlichsten durch den frühen Unfalltod von Linda, der jüngsten Schwester. Sie ertrank im Alter von vier Jahren im See unweit des Elternhauses, während Pia krank im Bett lag. Unausgesprochen wurde innerhalb der Familie Romi die Schuld für Lindas Tod gegeben, was nicht nur die ungleiche Behandlung der verbliebenen Schwestern verstärkte und schließlich zum Bruch mit Romi führte, sondern jenes Misstrauen in Pia entstehen ließ, das sie nun zu beherrschen beginnt.
Dabei ist es vor allem das Schweigen ihres Sohnes, das Pia triggert. Ähnlich wie damals die Mutter erzählt ihr nun der Sohn nicht, was eigentlich vorgefallen ist. Der Fantasie, den schlimmsten Gedanken und Befürchtungen der Protagonistin und damit auch der Leser:innen ist somit Raum gegeben.
Genauso wie Pia erfahren wir lange nicht, was damals am See und nun im Klassenzimmer passiert oder zumindest angeblich passiert ist. Viel mehr erfahren wir über Pia selbst, aus deren Perspektive – stets im Präsens – erzählt wird. Abwechselnd befinden wir uns mit ihr in der brüchigen Gegenwart und in der noch brüchigeren Vergangenheit.
Der Verlust der kleinen Schwester und das Schweigen um den Verlauf des Unfalls ist die eine Wunde, die Pia mit sich herumträgt. Mindestens genauso schwer scheint der Verlust der Stiefschwester zu wiegen, die als Nachrichtensprecherin Karriere gemacht hat und von Pia nun aus der Ferne – via Social Media – verfolgt wird. Die beiden waren gleichsam Verbündete wie Konkurrentinnen, mehr als einmal brachte Romi Pia in gefährliche Situationen, zum Beispiel als sie sie auffordert, einen bissigen Hund zu streicheln. Doch auch Pia ist Romi gegenüber nicht frei von Schuld, wie sich mit der Zeit herausstellt.
Was Schuld ist, wo Ungerechtigkeit und Gewalt beginnen und wie wir zu Täter:innen und zu Opfern werden, sind Fragen, an denen sich der Roman auf verschiedenen Ebenen abarbeitet. Auch der Umgang von Pias Eltern mit dem Trauma des Verlusts des eigenen Kindes wird durchleuchtet und dabei auch Kritik an traditionellen Familienmodellen vorgebracht, immer aus der Perspektive der Protagonistin. Da ist die Wut auf den eigenen Vater, der sich in seine Arbeit, in Schweigen und strenge Regeln flüchtete. Die Wut auf den Partner, weil er eine heile(re) Kindheit hatte. Da ist die vielschichte Wut auf die eigene Mutter, von der Pia mindestens drei verschiedenen Gesichter kennen zu glaubt.
Am komplexesten sind allerdings die Gefühle Pias gegenüber ihre Stiefschwester Romi und – gewissermaßen als Spiegelung davon – gegenüber ihrem Sohn Leon. In beiden meint sie etwas „Böses“ zu erkennen. Es ist eine der großen Stärken des Romans, das Grauen in den Momenten der Nähe aufkommen zu lassen und Familienszenen, die idyllisch, ja kitschig sein könnten, durch die argwöhnischen Gedanken der Protagonistin zu brechen. Ist es „ganz normal“, dass Leon eine Blindschleiche tötet oder hat das Glitzern in seinen Augen mehr zu bedeuten? Kann Pia ihren Sohn mit seiner kleinen Cousine alleine spielen lassen? Konnte Romi nicht wissen, dass der Hund Pia beißen und verletzen wird? Pia zweifelt am Guten, nicht zuletzt in sich selbst und entlarvt sich schließlich als unzuverlässige Erzählerin.
Vergangenheit und Gegenwart vermischen sich zunehmend und kulminieren in Kapitel 20 gekonnt in ihrem dramaturgisch notwendigen Ende. Eine vollständige Auflösung der Geschehnisse á la Agatha Christie gibt es zwar nicht, die Antworten auf einige der Schuldfragen werden allerdings recht klar ausformuliert, wie der Text sogar selbst einräumt: „Die letzte Besucherin, ich will sie beim Namen nennen. Ihr Name ist Schuld.“ (S.236)
Mir als Leser:in hätten die vielen, im Text verstreuten Details gereicht. Jene Szenen, in denen Pia selbst als Kind und schließlich auch als erwachsene Mutter zur Täter:in wird, sind stark und aussagekräftig genug, sie hätten nicht unbedingt eines Kommentars und oder einer Erklärung bedurft.
Im Vergleich zu Jessicas Linds eindringlichem und schauerlichem Debütroman Mama (Kremayr & Scheriau, 2021) ist Kleine Monster trotz des harten Themas inhaltlich leichter zugänglich. Auch sprachlich ist der Text aufgrund der vielen Dialoge, der eher kurzen Sätze und der effizient eingesetzten Handlungs- und Naturbeschreibungen sehr gut zu lesen. Die spezielle Mischung aus herausfordernden, aber an sich harmlosen, vielleicht sogar ein wenig lustigen Alltagssituationen, die wohl vielen Kleinfamilien bekannt vorkommen, und den tiefen Abgründen, die in uns und zwischen uns Menschen lauern, dramaturgisch so spannend zu entfalten, wie es der Autorin im vorliegenden Roman gelingt, ist eine große Leistung. Respekt, Schwester!