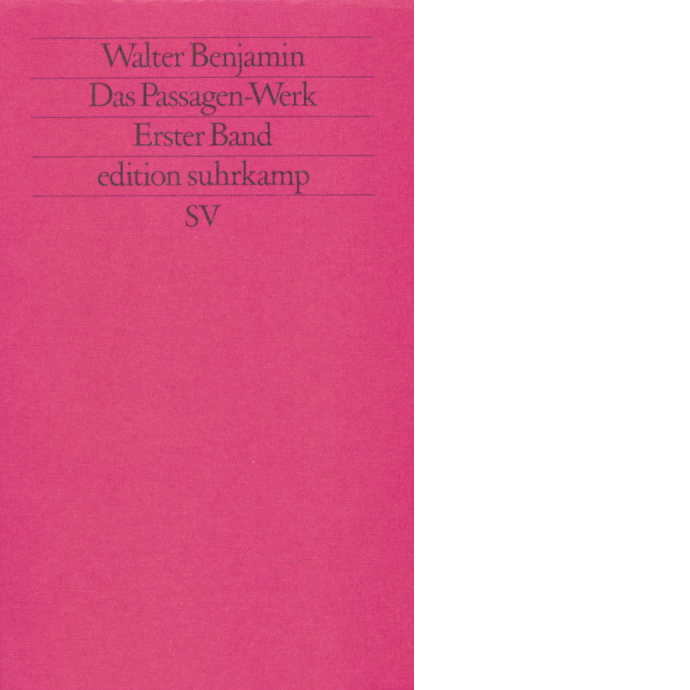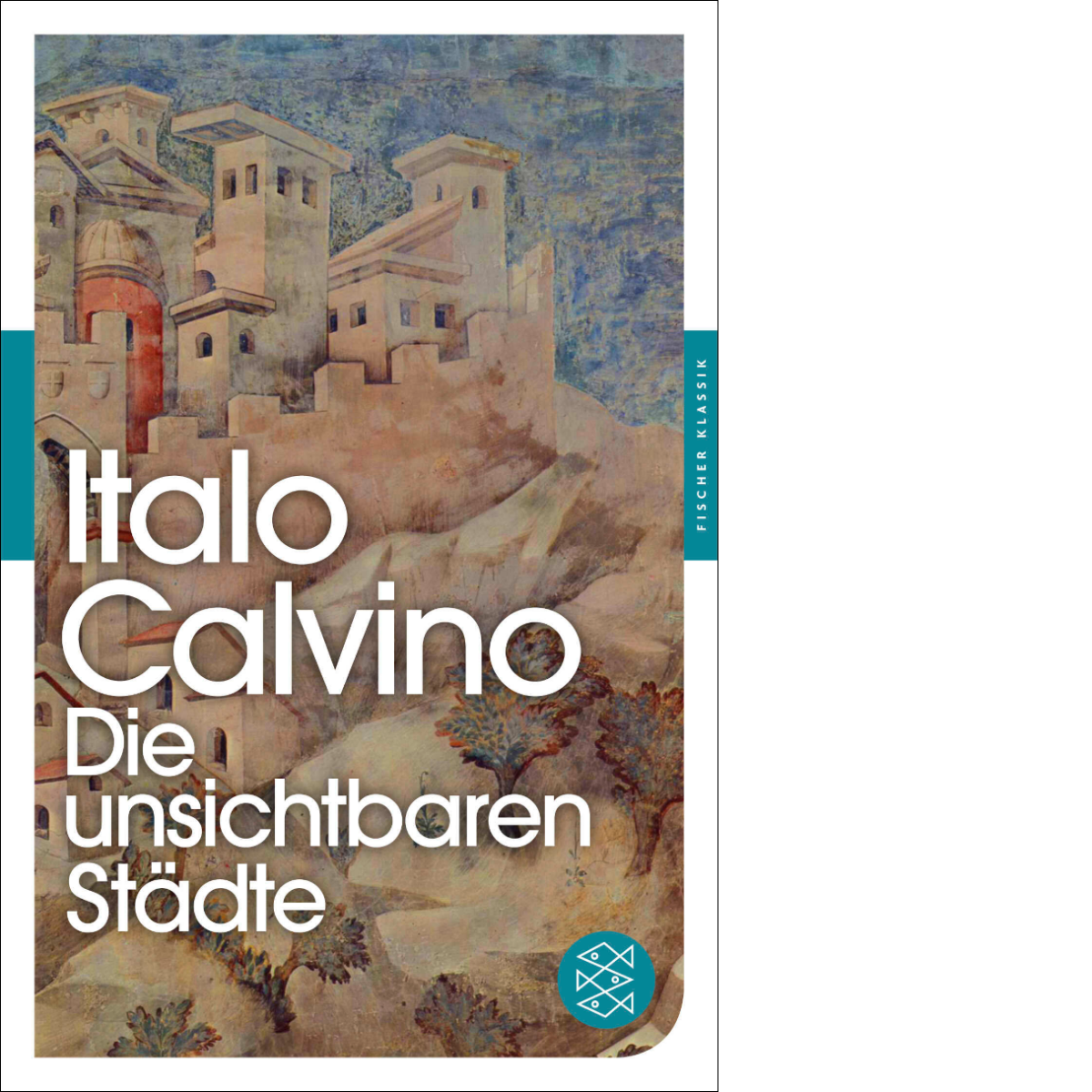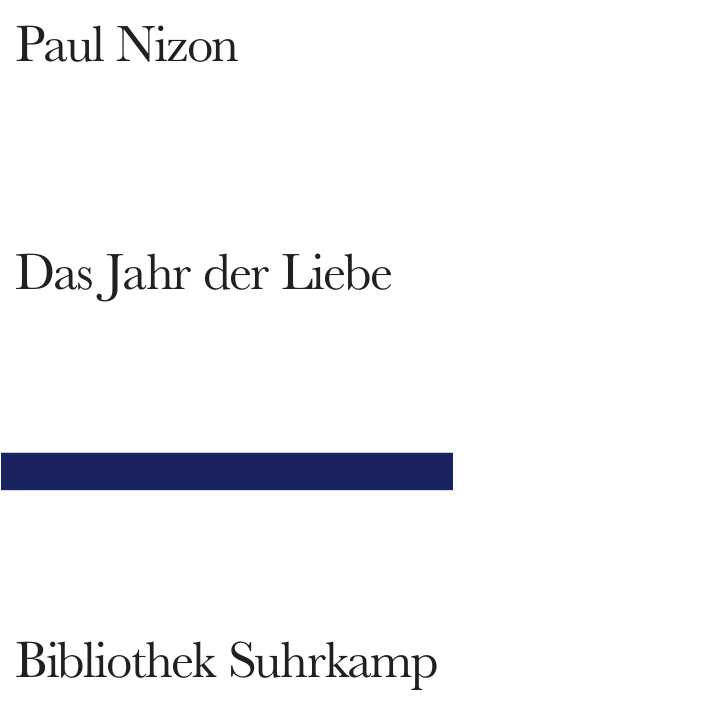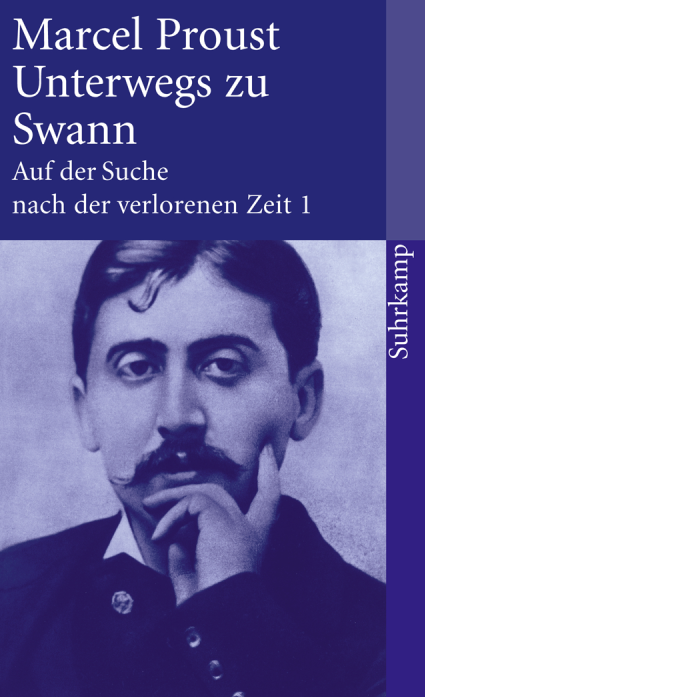Eine solche Stadt mag ein Ärgernis für Stadtplaner und Bedienstete der öffentlichen Verkehrsbetriebe darstellen. Für ein Denken out-of-the-box hingegen – wie es in manchen, oft empfindlich teuren Selbsterfahrungsseminaren heißt –, ist Literatur immer noch der beste Nährboden. Einer Stadt als Körper, der sich wandelt, der mitunter zuckt und seine Durchlässigkeit beweist, begegnet man in Gert Jonkes Erwachen zum großen Schlafkrieg. Hier begehrt ein Text gegen die Trägheit der Physik auf. Die stumpfe Metapher vom Leben auf vorgegebenen Schienen wird im anarchischen Übermut aufgebrochen. Auf einmal nimmt man auch die vormals abstrakte Infrastruktur als organische Umgebung wahr. Einfühlsam fragt man, welche Befindlichkeiten diesen Schienen derart zu schaffen machen und welche unerfüllten Wünsche unsere materielle Nachbarschaft denn noch so birgt.
Ganz anders als etwa in Fritz Langs cineastischem Meilenstein Metropolis (1927), in welchem die Anonymität wuchernder Großstädte in einer grellen Vision deutlich wird und die soziale Kluft sich im Stadtbild verfestigt, gestaltet Jonke einen Expressionismus, der den Schwerpunkt auf eine Stadtbetrachtung der unausgeschöpften Möglichkeiten richtet. Da wie dort verlassen die Mobile den Boden und steigen empor. Doch wie unterschiedlich gebärden sich diese Städte! In Jonkes Text horchen wir an wortgewaltigen Fassaden und ducken uns bei raumgreifenden Hauseingängen. Lesend entwickeln wir eine andere Beziehung zur Stadt. Die Gebäude unterliegen ihren menschlich anmutenden Bedürfnissen, sie husten, schütteln und grämen sich. Zuweilen geben sie sich trotzig.
Die Architektur hat ein Privileg vor allen anderen Künsten: Man kann sich ihren Objekten nicht beharrlich entziehen. Lediglich Eremiten meinen, sich außerhalb einer gebauten Welt setzen zu können. Aber tun sie das wirklich? In der Pinzgauer Kitzlochklamm soll bis vor einigen Jahrzehnten noch ein solcher Aussteiger gehaust haben. Selbst in dieser menschenverlassenen Einsamkeit schafft sich einer eine Umgebung, sucht eine Höhle und definiert einen Lebensraum. Die Objekte des Waldes werden zu Alltagsgegenständen, liefern das bemooste, feuchte Interieur für die asketische und meist wohl schrecklich ungemütliche Bleibe. Architektur versteht sich als das Gestalten von Raum und schafft eine gebaute Umgebung. Das Prinzip ist beim Eremiten also ident mit dem Errichten heiliger Tempel – seien es jene der Antike oder die in den Finanzdistrikten der Gegenwart.
Ein Buch mag man aus der Hand legen, einem Bild den Blick verwehren, gegen die Musik kann man im Notfall auch Ohrenstöpsel einsetzen, doch die Architektur bestimmt und gestaltet den Raum, sie definiert ein Außen und Innen, in dem wir uns bewegen, arbeiten, essen und schlafen. Die Fassaden leiten unseren Blick und der Raum strukturiert sich durch die Architektur.
„Der Flaneur ist der Priester des genius loci“
Wenn es etwas gibt, auf das ich nicht verzichten will, dann sind das Spaziergänge. Ich kämpfe um eine freie, also nicht definierte Zeit, die ich mit Schlendern zubringe. Das kapitale Diktat einer von permanenter Selbstoptimierung infizierten Lebensweise nötigt mich manchmal, mir im Kalender einen eigenen Termin genau dafür einzutragen. Gehe ich jedoch in meinem Flaneur-Modus erst einmal los, komme ich bald in der Absichtslosigkeit an. Bei Walter Benjamin (1892–1940) heißt es einmal erhaben, „der Flaneur ist der Priester des genius loci.“ Mit seinem Passagen-Werk (1927–1940) setzt er diesem neugierig-naiven Stadtbeobachter, der von seinen urbanen Jagden immer mit erlegten Erkenntnissen nachhause kehrt, ein Denkmal.2 Inspiriert wurde er nicht nur von seinem eigenen Flanieren, sondern von Büchern wie Sigfried Giedions Bauen in Frankreich (1928).
Räume zu ergehen, lässt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen zu. Rom ist als Stadt der sieben Hügel bekannt, aber wer spazierend Brüssel, Edinburgh, Triest, Wien oder gar Lissabon erkundet hat, stellt fest: die Topografie dieser Landschaften ist durch die Versiegelung nur ungenügend unterdrückt, denn vielerorts hebt und senkt sich der Untergrund mitunter beträchtlich. Je älter ich werde, umso eher stelle ich anhand meines hechelnden Atmens fest, dass sich die Stadt nur selten als ebene Fläche erweist.
„das Haus ist unser Winkel in der Welt“
Benjamin ist in der Philosophiegeschichte nicht einfach zuzuordnen, da er zeitlebens ein reflektierendes Einzelgängertum betrieben hat – bis zu seinem tragischen Freitod auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in Portbou/Spanien. Überhaupt nimmt die Architektur in der Geschichte der Philosophie keine souveräne Rolle ein; verglichen etwa mit Malerei oder Literatur. Immer wieder ist sie ihrer Identität als Kunstdisziplin beraubt worden. Schon in der Antike fokussieren viele Denker auf ihren Repräsentanz-Charakter. Die große Ausnahme stellt dabei Marcus Vitruvius Pollio (kurz Vitruv, lebte im 1.Jhd. v. Chr.) dar, dessen Zehn Bücher über die Architektur glücklicherweise in der Renaissance – wie so vieles vom guten Alten – wiederentdeckt wurden. Im deutschen Idealismus fertigt Immanuel Kant später die Baukunst in seiner Kritik der Urteilskraft lakonisch ab. Georg W. F. Hegel hingegen hält in seinen Vorlesungen über die Ästhetik (gehalten 1820–1829) die Architektur einer philosophischen Wertschätzung für würdig.
Das Match zwischen einer geisteswissenschaftlichen und einer technischen Zuordnung zieht sich durch die Jahrhunderte. Die Architektur wurde im 20. Jahrhundert mehr und mehr zu einer Disziplin der Ingenieurskunst. Ungeachtet dessen erschienen dennoch zahllose Abhandlungen über die Wechselwirkung von Subjekt und Raum, doch so richtig an vorderster Front in Kunstgeschichte und Philosophie findet sich die Architektur nur zeitweise. In Gaston Bachelards Poetik des Raumes heißt es: „Denn das Haus ist unser Winkel in der Welt. Es ist – man hat es oft gesagt – unser erstes All. Es ist wirklich ein Kosmos. Ein Kosmos in der vollen Bedeutung des Wortes. Ist nicht, als Intimität gesehen, noch die schlichteste Wohnung schön?“ 3
„Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich“
Das erste Oktavheft von Franz Kafka beginnt so: „Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich.“4 Der Raum um uns und der Raum in uns scheinen sich durch diese beiden Zitate die Hände zu reichen. Überbordend zeigt sich diese Verbindung im epischen Erinnerungswerk schlechthin, in Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu, erschienen zwischen 1913 und 1927). Hier führt eine Backware in Lindenblütentee getaucht zu einem phänomenalen Erinnerungsfuror. Das Erlebnisfeld der Kindheit wird in der fiktiven Landschaft erheblich ausgebaut, umfassender als je zuvor, intimer als es der Raum, durch den wir unsere Körper lenken, je sein könnte. Wer ein schmackhaftes Beispiel für den erhebenden Wert der Literatur sucht, kann sich daran ein Beispiel nehmen, denn anscheinend hat Proust ein Stück Zwieback gegessen, als ihn die biografische Epiphanie überkommt. Im Roman wird daraus bekanntlich eine süße Madeleine.5
Es wundert mich, dass in der Literaturwissenschaft erst mit den raumtheoretischen Überlegungen seit den 1970er- und 1980er-Jahren Architektur und Stadt zentral ins Blickfeld geraten, denn Texte über die Wechselwirkung von Außen- und Innen-Raum hat es immer wieder gegeben. Schon die berühmte, von Cicero in De Oratore überlieferte Anekdote von Simonides von Keos, der etwa 500 v. Chr. gelebt hat, ist ein hinreichender Beleg für die nahtlose Verknüpfung von realem und imaginiertem Raum. Simonides verlässt ein Gastmahl und plötzlich stürzt das Haus zusammen. Er überlebt, aber die anderen Gäste liegen unter den Trümmern begraben. Die Leichen sind derart verstümmelt, dass sie nicht identifiziert werden können. Nur weil sich Simonides an die Sitzordnung erinnert, können den Toten ihre Namen und ihre Geschichten wiedergegeben werden.
Diese Anekdote wird für gewöhnlich im Zusammenhang mit der antiken Mnemotechnik erzählt. Diese Geschichte macht deutlich, wie unverzichtbar räumliches Vorstellungsvermögen für unsere Konstruktion von Wirklichkeit ist. Auch wenn der Anlass – so ist zu hoffen – ein anderer ist, sind wir alle fortwährend Planer und Planerinnen. Die räumliche Anordnung eines Vortrags basiert auf einem argumentativen Fundament und bedient sich somit architektonischen Verständnisses. Unsere Sprachen sind voller Bilder des Bauens und der räumlichen Verortung. Manchmal verwenden wir meist unbedacht Metaphern, deren poetische Kraft an Anziehung eingebüßt hat, etwa wenn wir von einem Häusermeer oder von Straßenschluchten sprechen. In diesen blutleeren Bilderreichtum dringt auch Jonkes eingangs zitierte Erzählung ein und gibt der Architektur einen frischen sprachlichen Anstrich; ja mehr noch, sie sorgt für eine neue Fassade.
„Jetzt standen diese Häuser wie brave Tanten“
Selbst wenn die Stadt als Sujet in den Romanen ab der Moderne verständlicherweise mehr und mehr Raum einnimmt, so tut sie das oft in einem handlungsorientierten, psychologisierenden oder dokumentarischen Sinn. In Guy de Maupassants Bel-Ami von 1885 ist der Aufstieg des Hochstaplers Georges Duroy ohne Stadt undenkbar. Der Roman steckt voller Kammerspiele in verschiedenen sozialen Milieus im expandierenden Paris. Bekanntermaßen gehört Wien in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930-1943) zum festen Gesprächspartner des oft abgesonderten Ulrich. Auch er erweist sich als engagierter Vertreter der Promenadologie: „Er blieb nun wieder stehen, diesmal auf einem Platz, wo er einige Häuser erkannte und sich an die öffentlichen Kämpfe und geistigen Aufregungen erinnerte, die ihr Entstehen begleitet hatten. (…) Jetzt standen diese Häuser wie brave Tanten mit altmodischen Hüten in dem Spätnachmittagslicht, das schon zu verblassen begann, ganz nett und belanglos und alles andere eher als aufregend.“6
Urbane Erscheinungen lösen zuverlässig zu allen Zeiten Aufregungen aus, das hier beschriebene Loos-Haus auf dem Michaelerplatz ist bei seiner Errichtung 1910-12 genauso empörter Diskussion ausgesetzt gewesen, wie es vor kurzem die Umgestaltung eben dieses Michaelerplatzes ist. Mit sachlichen Befunden zur Architektur halten sich jedoch viele Protagonisten in den bekannten Großstadtromanen nicht auf. Ob es das wuselige New York in John Dos Passos Manhattan Transfer (1925) ist, das täglich unzählige Migranten aufnimmt, deren Gepäck leichter ist als ihr von Träumen beschwertes Herz, oder die morbide Wiener Stadt, deren monarchistisches Erbe in Heimito von Doderers Strudlhofstiege (1951) zerfasert, häufig zeigt sich die Stadt nach dem Ersten Weltkrieg als Moloch, der einen zu bezwingen droht. Und es gelegentlich auch schafft: Wer, wenn nicht Franz Biberkopf in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929), könnte das leichter bestätigen?
„in diesem riesengroß um mich gehäuften Paris, in dem sich ‚das Leben‘ verbirgt oder verliert“
Schließlich zeitigen Romane in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihren Stadtanamnesen neurotische Diagnosen, nicht zuletzt ist dafür Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin (1983) ein Beispiel, das neben vielem auch ein Porträt der Stadt als bürgerlichem Gefängnis ist. Da helfen nur Ausbruchsversuche in Thomas Bernhard’scher Manier, dessen Toben ganz eigene Stadtführer formvollendeter Schimpfkultur schafft. Manifestiert sich die Wut psychosomatisch, etwa durch pochende Leberschmerzen, greift man zur Kur am besten zu einem Buch wie Rom. Eine Ekstase (2009) von Hanns-Josef Ortheil. Obwohl hier Ekstase versprochen wird, ist es doch geordnete Begeisterung und eine Hymne auf das Äußere, das Versöhnliche südeuropäischer Lebensleichtigkeit.
Aber Vorsicht: Nicht überall, wo Rom draufsteht, ist auch Klassik drin! Denn das satyrhafte Rom, Blicke (1979) Rolf Dieter Brinkmanns weist einem Wege in urbane Abgründe, die man besser nicht aufsuchen sollte. Beide Bücher stecken voll städtischer Leidenschaft, deren Verschiedenheit kaum größer sein könnte. Während ich diesen Essay schreibe, entstehen gewiss weitere Romane, die sich am Urbanen abarbeiten. So emsig kann die Bautätigkeit in Shanghai oder Dubai nie sein, wie an den Schreibtischen aller Welt, wo die fiktiven Orte in praller Sinnlichkeit geradezu errichtet werden.
Stadtflucht und Stadtsucht halten einander die Waage in den Abertausenden Romanen, die der Stadt und Städten eine literarische Bühne bieten. Wie sehr sich Ruhelosigkeit in der Stadt anders gebärdet als am Land, demonstrieren Bücher chronischen Um-die-Häuser-Ziehens wie beispielsweise Paul Nizons Das Jahr der Liebe. Über 200 Seiten lang wälzt sich ein unablässiger Bewusstseinsstrom, der städtische Assoziationen mit Reminiszenzen vermengt und dabei auch das Schreiben erkundet: „Es ist wie Bleigießen, ich gieße mich in kleine Figuren in die Leere meines Tags, im Schachtelzimmer, in diesem riesengroß um mich gehäuften Paris, in dem sich ‚das Leben‘ verbirgt oder verliert. Wie der Sportler stürze ich mich in die Maschine und schnelle es hinaus, möglichst in einem Satz, gleichgültig was. Gleichgültig? Nein, es muss schon ein Lockstoff vorhanden sein.“7
Mit dem dafür geprägten Neologismus „Urbomanie“ lässt sich das ziellos hastende Alter Ego des Autors durch Paris treffend etikettieren, das den Liebestollen in seinen Klauen festhält. Die Mutter der Ausschweifung ist nicht die Freude, sondern die Freudlosigkeit, konstatiert der große Menschenkenner Friedrich Nietzsche.8 Wie sehr hätte man es ihm gegönnt, in Bezug auf sich selbst einsichtsvoller zu sein; aber dann wäre er wohl auch nicht der Nietzsche geworden, sondern Deutschlehrer in Basel geblieben.
„und darum wissen wir das stolze Glück einer Säule zu schätzen.“
Wer sich so aufopfernd sucht, mag weder am Land noch in der Stadt Ruhe entdecken. Interessanterweise stellt der Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin bereits 1886 in seiner Dissertation Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur die Frage, wie es möglich sei, „dass architektonische Formen Ausdruck eines Seelischen, einer Stimmung sein können“. In der Untersuchung konstatiert er eine Wechselwirkung von Wahrnehmung und Grundfragen der Ästhetik. So lässt sich die Übertragung auf die Stadt in völlig unterschiedlichen Facetten festhalten. Pointiert formuliert er eine grundlegende Erfahrung: „Wir haben Lasten getragen und erfahren, was Druck und Gegendruck ist, wir sind am Boden zusammengesunken, wenn wir der niederziehenden Schwere des eigenen Körpers keine Kraft mehr entgegensetzen konnten, und darum wissen wir das stolze Glück einer Säule zu schätzen.“9
So buchstäblich ist das Aufrichten an Objekten und Gebäuden selten festgehalten worden. Ebenfalls bahnbrechend für einen spatial turn10, lange bevor dieser Begriff überhaupt in den Seminaren herumzugeistern begonnen hat, ist Camillo Sittes Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.11 Die 1889 erschienene Abhandlung befasst sich unter anderem mit Platzgrößen und dem Angstpotenzial, das besonders große Plätze aufweisen. Sitte ist jahrelang – hauptsächlich in Italien – von Stadt zu Stadt gereist, um Stadtentwicklungen zu studieren. Dabei ist er oft vom Bahnhof direkt ins Stadtzentrum gefahren oder gegangen, hat den höchsten Turm bestiegen und sich aus der Vogelperspektive einen grundlegenden Eindruck verschafft.
Die asymmetrischen, kleinen Plätze gerade der italienischen Städte mit ihren Händlern und Gauklern haben ihn fasziniert, im Gegensatz zu jenen Plätzen des 19. Jahrhunderts, die für Aufmärsche gut sind und in deren Zentrum ein pompöses Denkmal steht – wie ja in Wien mehrfach festzustellen ist. Diese Plätze sind ganz einem aristokratischen Geist verhaftet. Die Ringstraße ist unter anderem deshalb kein Ring, sondern ein Pentagon, weil es auf geraden Straßen dem Militär leichter fällt, auf einen aufständischen Mob zu schießen. Den Habsburgern saß der Schrecken des Revolutionsjahres 1848 bei der Stadterneuerung im Nacken. Stadt und Psyche sind spätestens ab der Gründerzeit ein festes Paar.
„Am Boden zeigen die Einwohner sich nur selten“
Rarer sind hingegen Bücher, die mit poetischer Hingabe Städtebilder gestalten, in welchen sich kein Subjekt – auf welche Weise auch immer – echauffieren muss. In Italo Calvinos Die unsichtbaren Städte (Le città invisibili, 1972) scheint ein solcher, sich in den Vordergrund drängender Erzähler zu fehlen. Dabei ist hier Marco Polo genannt, der dem Kublai Khan von den Städten seines Reiches berichten muss. Sein Problem: Er kennt sie nicht. Er findet bei seiner Fantasie Zuflucht und erzählt von wundersamen Städten, dabei entwickeln sich in meist nur eine Seite langen Miniaturen unverbrauchte Betrachtungen auf Architektur und Städtebau.
In der Miniatur Die Städte und die Augen ist von Baucis die Rede. Es ist auf dünnen Stelzen errichtet und reicht in die Wolken hinein: „Man steigt auf kleinen Leitern hinauf. Am Boden zeigen die Einwohner sich nur selten; sie haben schon alles Notwendige oben und ziehen es vor, nicht herunterzukommen. Nichts von der Stadt berührt den Boden außer diesen langen Flamingobeinen, auf denen sie ruht, und an sonnigen Tagen ein perforierter eckiger Schatten, der sich auf den Blättern abzeichnet. Drei Hypothesen gibt es über die Einwohner von Baucis: dass sie die Erde hassen; dass sie genug Respekt vor ihr haben, um jeden Kontakt mit ihr zu meiden; dass sie die Erde lieben, so wie sie vor ihnen war, und nicht müde werden, sie mit abwärts gerichteten Ferngläsern und Teleskopen zu bewundern, Blatt für Blatt, Stein für Stein, Ameise für Ameise, um fasziniert die eigene Abwesenheit zu betrachten.“12
Es ist ein wiederkehrendes Motiv bei Calvino, dass erst die Distanz die Nahaufnahme ermöglicht. Im Surrealismus steckt immer so viel Realismus, dass man sich ertappt fühlen mag. Womöglich ist es auch eine Vision, wie wir in hundert Jahren leben, wenn wir die Erdoberfläche endgültig verwüstet haben. Das wäre die vierte Hypothese für Baucis: Dass wir aufgrund des Anthropozäns gezwungen sind, unsere Wohnsitze in die Höhe zu verlagern, „ein paar Meter luftaufwärts ziehen“, wie es eingangs heißt … ganz so wie Calvinos Der Baron auf den Bäumen13 … fernab brandender Ufer und verdorrter Böden.
Die Betrachtung aus der Ferne, um Intimität zu erzeugen, gilt schließlich nicht nur für das Motiv der Stadt in der Literatur; sie ist vielmehr immer ein wesentlicher Motor, weshalb wir weiterlesen, weiter durch die Bücher gehen wie durch verwinkelte Gassen.