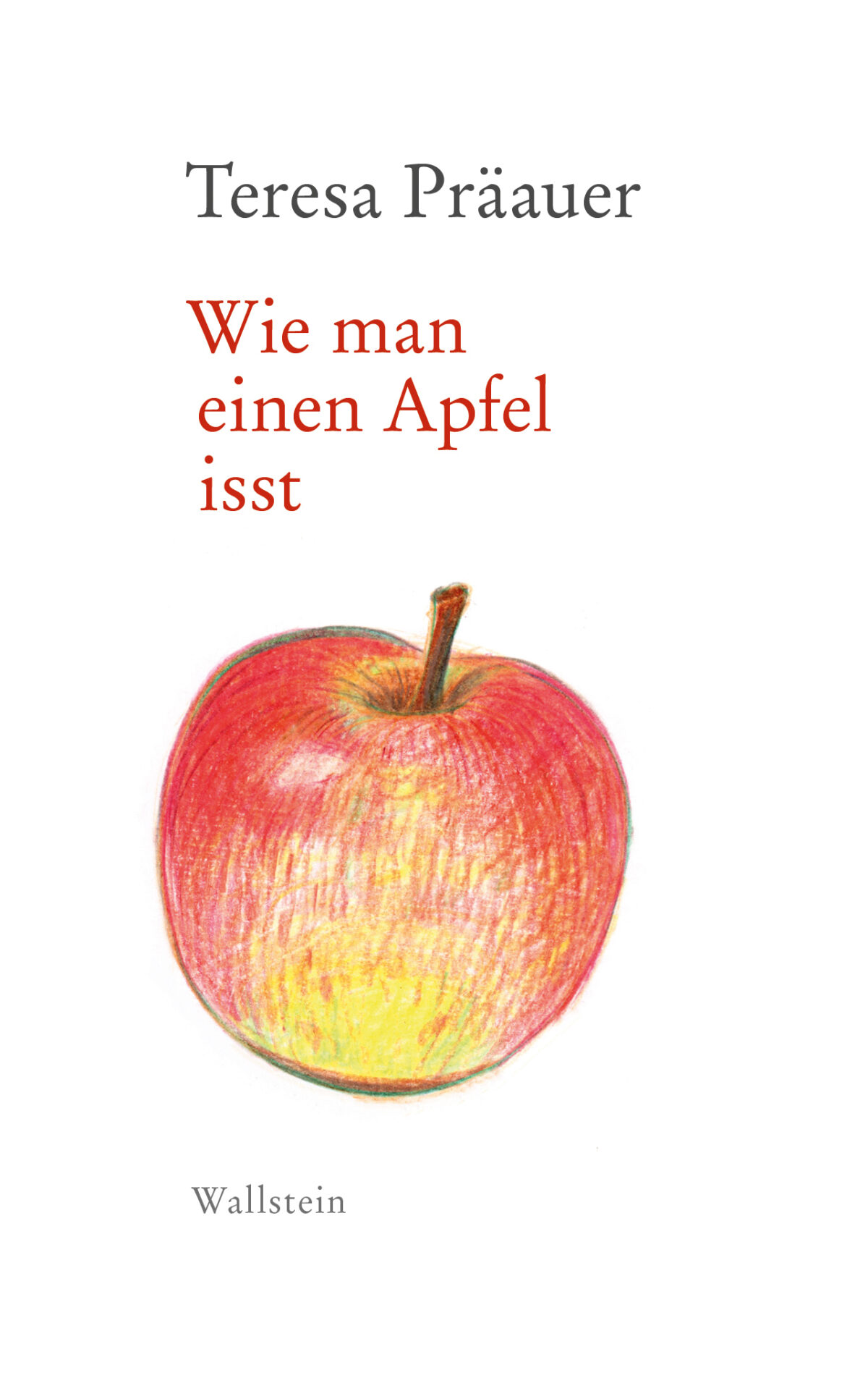Aufgefordert, zum Dank für die Zuerkennung eines Literaturpreises das Wort zu ergreifen, steht Autor:innen eine Vielzahl an Optionen offen: Soll man sich vor einem kundigen Publikum selbst erklären, die Ursprünge und Tiefenschichten des Schreibens freilegen, die eigenen Texte auf ihre Verbindungen zur Literaturgeschichte abklopfen? Zeigt man sich unbeeindruckt oder gerührt, bescheiden oder aufrührerisch, abgeklärt oder euphorisiert? Stattet man den Stiftern pflichtschuldig Dank ab, oder setzt man sich polemisch in Szene?
Teresa Präauer hat jüngst einen genuin erzählerischen Weg gewählt: Am 22. Jänner 2024 wurde sie für den Roman Kochen im falschen Jahrhundert mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet. Sie folgte damit auf Thomas Stangl, dessen Roman Quecksilberlicht ein Jahr zuvor prämiert worden war: Österreicher:innen unter sich, und doch zwei ganz unterschiedliche literarische Temperamente. In ihrer Preisrede, die nun gemeinsam mit einer bislang unveröffentlichten Geschichte unter dem Titel Wie man einen Apfel isst erschienen ist, zeigt sich Teresa Präauer als leichtfüßige, souveräne Erzählerin – als Meisterin kleiner Textformen, die sich vom scheinbar Nebensächlichen unversehens zu den großen Themen der Kunst aufschwingen.
Ein Enkel, der dem Großvater aufmerksam dabei zusieht, wie er Alltägliches verrichtet, routiniert und bedächtig, seiner Sache gewiss: Man ist versucht, beim Setting von Teresa Präauers Wie man einen Apfel isst an Adalbert Stifter zu denken. Der Erzähler schaut dem Großvater genau auf die Finger: wie er die Ärmel hochkrempelt, das Tischtuch glattstreicht, das Schneidbrett zurechtlegt, seine Hose zum Schutz vor Flecken mit einem Tuch bedeckt. Auf das Kind, das die folgende Zerteilung des Apfels gebannt verfolgt, wirken die Gesten groß und bedeutend, ja „theatralisch“ (S. 8).
Teresa Präauer hat sichtlich Freude daran, vom gemeinsamen Apfelverzehr der beiden zu berichten. Sie jongliert mit dem literarischen Sujet des weisen Großvaters, folgt ihm und nimmt es zugleich nicht ganz ernst. Gerade weil Wie man einen Apfel isst nicht mit poetologischer Gravität daherkommt, ist der Text eine charmante Reflexion über das Schreiben und die Literatur. Hier wird weder mit dem Holzhammer philosophiert noch mit dem philologischen Silberbesteck feinfiletiert, sondern kunstvoll und zugleich einnehmend mit dem Apfelmesser gearbeitet.
Die Literatur: in den Worten des Großvaters ein Ort, „an dem du Äpfel mit Birnen vergleichen kannst“ (S. 12), ein Ort der Neugier und der überwundenen Konventionen: „Seine Zuversicht hatte in diesem hochfliegenden Moment, bevor sie wieder auf dem Boden landen und in den Küchenschränken des Alltäglichen verräumt werden würde, etwas Utopisches.“ (S. 13) Präauers Text ist eine Erinnerung an das, was (uns) Literatur bedeuten kann: schwärmerisch, verspielt und, wie es vom Großvater im Utopie-Modus heißt, „voller Übermut“ (S. 14).
Ein zweiter Text als Zutat macht aus der zehnseitigen Rede ein schmales, schön gestaltetes Büchlein (Cover und Illustration wie üblich von Präauer selbst): Eine Frau spaziert mit ihrem vierjährigen Neffen durch eine regnerische Stadt. „Kennst du den Zufall?“, fragt das Kind, und die Erzählerin beginnt zu grübeln, was sie auf diese „verblüffend philosophische Frage“ (S. 17) bloß antworten soll. Kann das Grimm’sche Wörterbuch Abhilfe schaffen, oder doch der pakistanische Pizzabäcker im Souterrain? Man folgt den beiden gern auf ihrem Spaziergang, vorbei an Schafgarben und Hunden, gerade weil nichts Spektakuläres passiert. Ein freundliches und kluges Buch in fordernden Zeiten.
Harald Gschwandtner, geb. 1986, Literaturwissenschaftler, Kritiker und Lektor, Senior Scientist im Literaturarchiv Salzburg. Veröffentlichungen zur österreichischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, u. a. Strategen im Literaturkampf. Thomas Bernhard, Peter Handke und die Kritik (Böhlau, 2021).