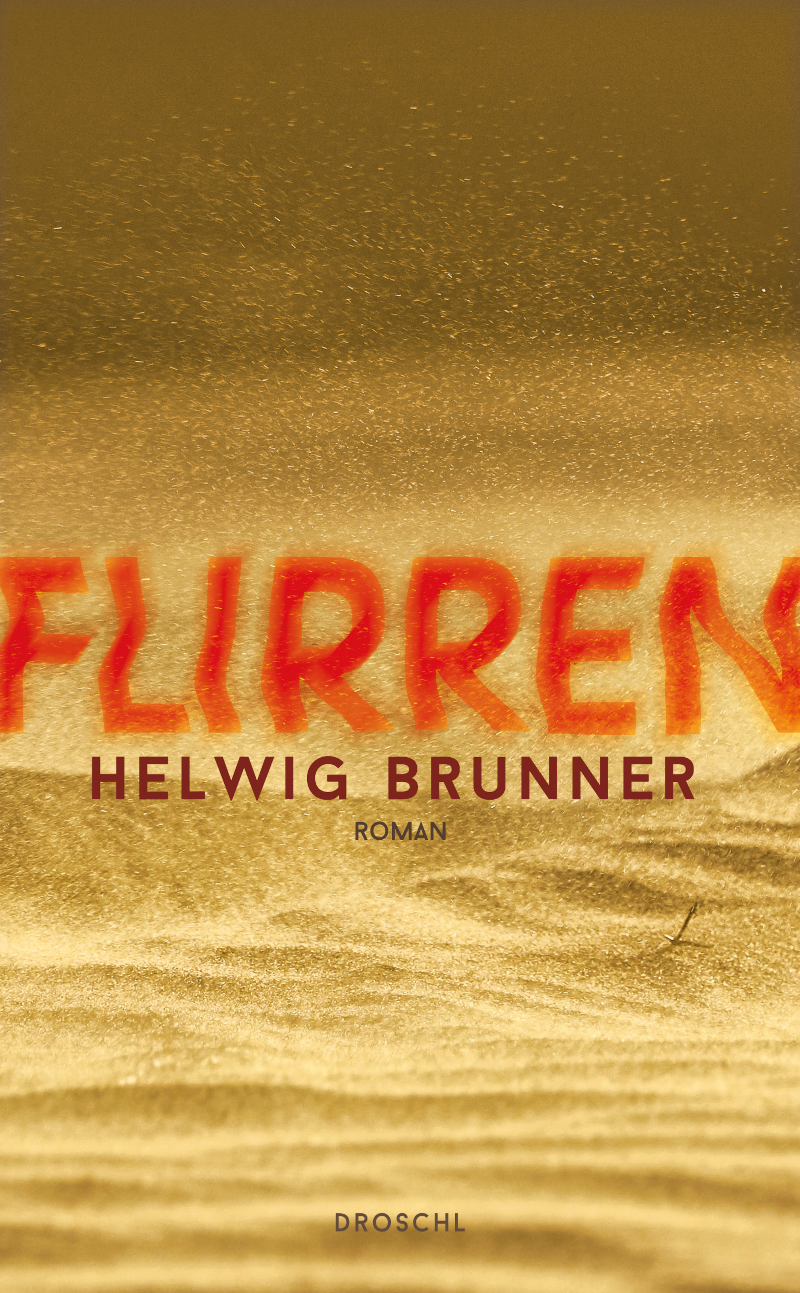Im 25. Jahrhundert leben die Menschen in gedrängten Humanarealen und sind angesichts eines durch Klimakatastrophe, Technologiegläubigkeit und Atomkrieg zerstörten Außen auf die Enge eines streng regulierten Innen angewiesen. Das titelspendende Flirren der Luft, eine permanente Erinnerung an das Unwiederbringliche, gibt die (auch sprachlich) vieldeutige Rahmung einer bedrohlichen Atmosphäre ab: Leonard, ein „Vergangenheitsforscher“ (S. 91) in Zeiten des berechenbaren Aussterbens, ist Bewohner eines dieser Areale in denen eine bürokratische Elite Aufgaben verteilt, kontrolliert, sanktioniert und auch selektiert.
Die Menschen, ein mutloses Auslaufmodell, werden auf eine Existenz im „Ameisenstaat“ (S. 41) reduziert, Ressourcen aber auch Gefühle sind Mangelware. Das Ringen ums Überleben wirkt angesichts der Umstände wie eine Form der Ablenkung, der Unfall ist sozusagen schon längst passiert. Leonard beforscht genau diese Umstände, sein Auftrag, erteilt von ominösen Behörden, ist die klitternde Zusammenstellung und Beforschung der Vorgeschichte seiner Gegenwart – mithin die Geschichte der Verfehlungen und Verheerungen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts.
In seiner historiografischen Aufgabe – die zeitlich wenig zufällig auf erlebte Vergangenheit und unmittelbare Gegenwart einer potentiellen Leserschaft des vorliegenden Romans ausgerichtet ist – verbinden sich übergeordneter Verlust und individuelle Trauer. Zwischen Geschichtsschreibung und Geschichten, zwischen Historie und Anekdote navigiert Leonard die Leserschaft durch eine Wirklichkeit, in der die Zukunft der Menschheit ihr unvermeidliches Ende bedeutet. Das Aufrufen kultureller Techniken des Lesens, Zitierens und Schreibens wird als nachträgliche Fixierung der Zerstörung erfahrbar, das Sehnen nach Hoffnung ist einer allumfassenden, wortwörtlichen Weltverwüstung unterworfen, die jedes Detail der von Brunner entworfenen Dystopie durchdringt.
Leonards Tätigkeit entfaltet sich in Flirren als Aufzeichnung über das Schreiben, als ein Reflektieren denkerischer Prozesse und nicht zuletzt als unnachgiebiger, harter Kommentar einer entworfenen Zukunft über unsere nur zu wirkliche Gegenwart.
Es erscheint deshalb nur konsequent, dass Leonards Welt, ein System im zunehmenden Zusammenbruch, vollkommen von Formen der gegenseitigen Überwachung und Denunzierung strukturiert ist: „Es ist eine paranoide Welt; man zweifelt an seinem Verstand und weiß nicht, wer einen ans Messer liefert, wer wem worüber Bericht erstattet, was inhaltliche Anforderung ist, was Kontrollinstrument und was Ausgeburt der eigenen Neurosen […].“ (S. 13)
Sein forscherischer Auftrag ist somit Möglichkeit der Kontrolle durch das System und der Beschäftigung, ist Arbeit in einer Zukunft, in der die Gesamtheit des Wissens ohnehin via Upload zur Verfügung steht – wenngleich sich auch hier für den Protagonisten bald enge Grenzen und Zensurmechanismen zeigen. Sein Bericht, in den wir als Leser:innen nie Einblick bekommen, fußt auf einer Haltung des schreibenden Flüchtens, die niemals (und: in keiner Hinsicht) vom sprichwörtlichen Fleck kommen kann: „Was ich hier denke und schreibe, gehört allen, so es denn jemand haben und lesen will, und ich bediene mich meinerseits an allem, was das System mir zugänglich macht.“ (S. 34)
Das geteilte Weltwissen dieser Zukunft ist zumindest auf zwei Ebenen ein fragwürdiges Miteinander: Einerseits werden hier Formen des Hoffens, Wissens und Lebens aufgerufen, die nicht mehr in der Lage sind, die eigenen Bedingungen zu reflektieren; andererseits schreibt sich der Verlust von Dissens und Kritik in die begrenzten sozialen Interaktionen dieser tatsächlich letzten Generationen ein. Der von Leonard erstellte Bericht legitimiert seine Stellung innerhalb dieser Überwachungsgesellschaft, ist zugleich aber, weil unter dem Druck von Evaluierung und Leistung durch die Obrigkeit stehend, auch Ausdruck permanenter Bedrohung (körperlicher) Existenz.
Anhand von Nebenfiguren demonstriert Brunner die Kaltblütigkeit einer Gesellschaft, in der der Einzelne stets überflüssig ist: Menschen werden mit erstaunlicher Geschwindigkeit umprogrammiert, bestraft oder aus den Habitaten verbannt. Dass sich das wiederholt aufgerufene „Hoffnungszeitalter“ (S. 196) trotzdem im Roman benannt und verhandelt findet, überrascht zumindest im ersten Moment. Doch die Hoffnung, die sich hier auch an Formen literarischer Widerständigkeit entwickelt, ist eine, die nicht mehr am Humanen, sondern ausschließlich am Humanistischen orientiert ist: „Die Hoffnung, von der ich zu sprechen vermag, gilt nicht dem Menschen, sondern der Menschlichkeit.“ (S. 198)
Helwig Brunner gelingt mit Flirren ein eigenständiger, unbequemer und wohl auch deshalb so wichtiger literarischer Beitrag zur aktuell vieldiskutierten Climate Fiction. Sein Roman teilt durch die Darstellung einer menschengemachten Zerstörung der Welt, die tiefenhistorische Perspektive oder die Verhandlung ethischer Aspekte des (Über-)Lebens unter Krisenbedingungen wesentliche Strukturmerkmale mit anderen, medienübergreifend nachweisbaren Werken, die sich dem Dachbegriff der Climate Fiction zuordnen lassen. Im Gegensatz zu rezenten literarischen Beispielen verklärt-utopischer Entwürfe oder der Zelebrierung des Untergangs verlegt sich Brunner – auch geprägt durch seine wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Biologie und ökologischen Folgeabschätzung – auf eine literarische Strategie der Plausibilität.
Schon der Sprung in die ferne Zukunft ist dem Wunsch nach einer möglichst realistischen Darstellung generationsübergreifender Veränderungen geschuldet, eben weil es, einem Gedanken der australischen Anthropologin und Soziologin Vicky Kirby folgend, eben kein Außerhalb der Natur geben kann. Diese Tatsache verbindet Brunner überaus gelungen mit der Verhandlung unserer Gegenwart: Die fantastische Literatur, und auch dieser Kategorie entspricht sein Roman, erzählt nicht zuletzt auch über die Gegenwart und die Herausforderungen realer Entwicklungen an Potenziale literarischer Imagination.
Flirren – durchdrungen von zahlreichen, höchst unterschiedlichen Referenzen – ist durch die vorgenommene Fokussierung somit als Kritik am Fortschritt, der die Menschen hinter sich gelassen hat, aber auch an der politischen Verführbarkeit ebendieser höchst fragilen Spezies lesbar. Wenn Brunner, obzwar nie direkt ausformuliert, nach dem Wirklichkeitspotenzial des Möglichen fragt, erweitert er das Titelwort einmal mehr in Richtung der Sprache, die in diesem dringend zu empfehlenden Zukunftsroman Mittel und Gegenstand zugleich ist.
Thomas Ballhausen, Autor, Philosoph, Hochschullehrer, lebt in Salzburg und Wien. Portrait von Thomas Ballhausen auf der Homepage der edition keiper