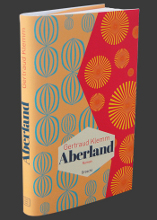Abwechselnd erzählt wird aus der Sicht der 58jährigen Elisabeth und ihrer Tochter Franziska. Die Biologin ist Mitte dreißig und Mutter eines Sohnes im Kindergartenalter. Während Elisabeth in ihrer früheren Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter auf den ersten Blick vollständig aufgegangen zu sein schien, hadert Franziska von Beginn an mit ihrer Entscheidung für die Familie und gegen ihren Beruf. Gefangen im „Muttiversum“, fühlt sie sich von ihrem Mann allein gelassen: mit Bergen von Wäsche, dem Einkauf, Kochen, Basteln und Backen für Kindergeburtstage und Sommerfeste im Kindergarten. Für den Abschluss ihrer Dissertation über Zebrafische fehlt ihr nicht nur die Zeit, sondern auch jede Energie.
Yogaübungen im Keller und kleinstädtische Kulturbesuche mit ihrer kinderlosen Freundin Beatrice sind winzige Freiheitsinseln im ansonsten völlig fremdbestimmten Hausfrauen- und Mutter-Alltag. Eine kurze Affäre mit dem fünfundsechzigjährigen Künstler Jakob bleibt Franziskas gewagtester Ausbruchsversuch aus der Enge des gesellschaftlich verordneten gutbürgerlichen Familienglücks in der Vorstadtsiedlung. Ansonsten entspricht sie den Erwartungen. Den Erwartungen der anderen. Auf der Weihnachtsfeier ihres frisch beförderten Mannes spielt sie die stolze Ehefrau, beim Kindergartenfest die glückliche Mama und Ostern bei Toms Familie in Tirol die brave Schwiegertochter. Für die steht das längst fällige zweite Kind auf dem Plan. Halbherzig lässt sie sich darauf ein und wird erneut schwanger. Franziska schwankt zwischen Trauer und Erleichterung, als sie die Schwangerschaft abbrechen muss, da ihre ungeborene Tochter wegen eines Gendefekts nicht überlebensfähig ist. Doch nur so bleibt ihr genug Luft für ihre Dissertation. Denn eins will Franziska auf keinen Fall: So werden wir ihre Mutter Elisabeth. Ihre Mutter war nie berufstätig. Seit die Kinder aus dem Haus sind, langweilt sie sich mit Ehemann Kurt in ihrer noblen Villa in den Lebensabend hinein.
Mit im Haus lebt die demente Schwiegermutter mit ständig wechselnden Pflegekräften. Todesengel nennt sie Elisabeth. Aus der dumpfen Einsamkeit und lähmenden Perspektivlosigkeit flieht Elisabeth, so oft sie kann, zum Joggen oder Bräunen ins Freibad, noch lieber zur Schönheitsbehandlung ins Kosmetikstudio. Anti-Aging ist ihr einziger Lebensinhalt. Die Frage ist nur, für wen? Mit dem frisch ausgemusterten Pensionisten zu Hause hat sie nur Mitleid: Wie wird es Kurt ohne seinen Beruf und seine dauernden Affären zu Hause wohl aushalten? Der wütet mit Gift gegen Gartenschädlinge und Buchsbaumzünsler, als könne er damit das eigene Altern und Sterben ausmerzen.
Auch Elisabeth sucht vergeblich emotionale Zuwendung beim Künstler Jakob. Doch für sie gibt es nur einen einzigen wirklichen Lebensmenschen: ihre Freundin Edith. Aber Edith ist schon seit Jahren tot. Die Sehnsucht nach ihr ist geblieben. Vielleicht träumt sie deshalb von einer Liebesbeziehung zu Gustav, dem Ehemann der Verstorbenen. Wie alle anderen Träume bleibt auch dieser unerfüllt.
Elisabeth und Franziska teilen nicht nur ohne Wissen den gleichen Liebhaber. Mutter und Tochter fallen auch in das gleiche Rollenschema. Dazu scheinen Frauen biologisch prädestiniert und gesellschaftlich verdammt zu sein. In die gutbürgerliche Enge getrieben, führen sie ein Leben wie unter Glas: die klassische Hausfrau Elisabeth genauso wie die vermeintlich emanzipierte Töchtergeneration Franziskas, die ihre eigene berufliche Karriere scheinbar „freiwillig“ der Familie opfert. Gefangen, wie die mit Wittgenstein berühmt gewordene Fliege im Fliegenglas, suchen sie vergeblich einen Ausweg aus der Frauen-und-Mütter-Falle, die auch eine Sprach- und Denk-Falle ist. Jedes „Ja, aber …“ steht für das kollektive weibliche Traumverbot. Im „Aberland“, der Parallelwelt der Frauen und Mütter, werden Bedürfnisse und Wünsche eingeschränkt, noch bevor sie ausgesprochen sind.
In ihrem Roman Aberland macht Gertraud Klemm diesen Mechanismus weiblicher Selbstzensur aus der beklemmend gefühlsecht beschriebenen Innensicht der beiden Frauen heraus sichtbar. Aberland ist eine oft bitterböse Sprach- und Denkanalyse weiblicher Selbsttäuschung und ein feministischer Appell. Denn um der Fliege den Ausweg aus der Fliegenfalle zu zeigen, muss diese sie allererst wahrnehmen. Sicher gibt es objektiv existenziellere Nöte als die der finanziell und sozial gut abgesicherten Frauen Elisabeth und Franziska. Subjektiv kann ein Leid aber nie gegen ein anderes aufgewogen werden. Und das von Elisabeth und Franziska betrifft, objektiv gesehen, in unterschiedlichster Ausprägung alle Frauen. Wenn auch nicht immer auf so privilegiertem Niveau.