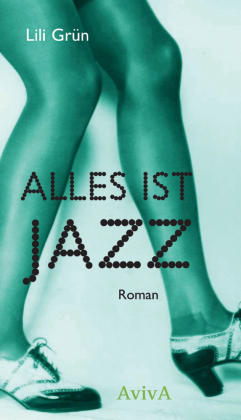Die 1911 geborene, also um sieben Jahre jüngere Hilde Spiel kannte einst die gebürtige Wienerin Lili Grün. 1976 schrieb die Kritikerin und Essayistin, deren eigene Prosaarbeiten bis heute zu wenig bekannt und recht unverdient in Vergessenheit geraten sind, über Lili Grün: „Jene Flüchtlinge und Auswanderer, die Österreich nach dem Anschluß verließen, hatten ihrer Heimat zum größten Teil unter Zwang entsagt. … Wenige kehrten zurück, so sehr sie auf den Tag, an dem dies möglich sein würde, gewartet hatten. Viele der verfolgten und ausgestoßenen Schriftsteller hatten die Jahre der Hitlerherrschaft gar nicht überlebt. In Vernichtungslagern starben unter vielen anderen … Lili Grün …, ein rührendes Mädchen, das mit seinem zarten Roman Herz über Bord zum ersten Mal in dem fatalen Jahr 1933 hervortrat. Ihre Lebensgeschichte bliebe im dunkeln, und sie wäre vom Erdboden weggewischt, als hätte es sie nie gegeben, würde ihrer hier nicht Erwähnung getan.“
Für viele, viele Jahre war dies der letzte deutliche Hinweis auf diese Autorin und ihre Bücher. Aufgewachsen als Tochter eines jüdischen Schnurrbartbindenfabrikanten, Parfümeriewaren- und Friseurbedarfsartikelhändlers in der Arnsteingasse in Wien-Rudolfsheim, musste Lili 1915 den überraschenden vorzeitigen Tod ihrer Mutter verkraften, wurde zur Kontoristin ausgebildet, pflegte aber hingebungsvoll den Traum von einer Karriere als Schauspielerin und zog deshalb Ende der 1920er- Jahre nach Berlin. Rechnete sie sich doch dort größere Chancen aus, was sich aber nicht bewahrheiten sollte. Trotz einer fast unüberschaubaren Zahl an Theater- und Kabarettbühnen, an Variétés, Rundfunk- und Filmstudios war die Zahl arbeitsloser Schauspielerinnen und Schauspieler infolge der Weltwirtschaftskrise enorm hoch. 1931 gehörte Lili Grün zum Gründungsteam des Kabaretts „Die Brücke“, die im Keller des Hauses des Vereins Berliner Künstler in der recht zentral gelegenen Bellevuestraße 3 auftrat. Bald schon kehrte Grün, die in der deutschen Hauptstadt zu schreiben begonnen hatte, nach Wien zurück; am 16. März 1933 kam im Zsolnay Verlag ihr Roman mit dem ausgesprochen kästnerischen Titel „Herz über Bord“ heraus, der nun, nach mehr als 76 Jahren, erstmals wieder nachgedruckt wurde, mit einem neuen, ganz sacht die Leitmotive des Romans verfehlenden Titel versehen.
Drückende Armut, Fehlernährung und Hunger hatten Lili Grün physisch so angegriffen, dass sie 1935 mehrere Wochen lang zur Behandlung in ein Lungensanatorium in Südtirol reisen musste. Davor stand allerdings eine Spendenaktion, denn sie selber konnte sich dies finanziell nicht leisten. Im Herbst jenes Jahres erschien ihr zweiter Roman, „Loni in der Kleinstadt“, 1936/37 druckte der „Wiener Tag“ in Fortsetzungen ihren Angestelltenroman „Junge Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit“ nach. Der März 1938 ließ auf einen Schlag Lili Grüns letzte Verdienstmöglichkeiten versiegen. Der Fluchtweg ins Ausland stand ihr, weil völlig verarmt und schwer krank, nicht offen, ab Sommer 1938 wurde ihr eine Odyssee durch mehrere Wohnungen auferlegt, zuletzt war sie in einem „Massenquartier“ in der Neutorgasse 9 im Ersten Wiener Bezirk untergebracht. Bis sie am 27. Mai 1942 mit 981 weiteren österreichischen Jüdinnen und Juden nach Osten deportiert und fünf Tage später, am 1. Juni, dem Tag, an dem sie in Maly Trostinec in Weißrussland ankam, ermordet wurde.
Dies ist die bittere biographische Folie für ihren bestrickend leichten wie leicht zu lesenden Kabarett-Künstler-Berlin-Roman. Elli, die zentrale Protagonstin, aus Wien gebürtig und wegen der Künste nach Berlin gezogen, ist eine junge Schauspielerin, die sich nur schlecht, nie aber recht durchschlägt, die als eher dunkler, frecher Typus den damaligen Besetzungswünschen von Film und Bühne – groß, blond, sinnlich und lockend – nicht entspricht. Mit entsprechenden Folgen. Die sich vor allem am Monatsende summieren. Beziehungsweise nicht zur Zimmermiete von 40 Mark summieren wollen. Verliebt ist sie seit kurzem in einen den darstellenden wie allen anderen Künsten gänzlich abgeneigten Studenten namens Robert, der – und schon dies sollte Warnung genug sein, dass ihrer Liebe keine große Zukunft gehört – ein rigides Zeitmanagement betreibt. Elli-Zeit heißt: zwei Abende pro Woche. Alles andere ist strikt anders verplant. Doch da gibt es ja noch die keineswegs auf den kessen Mund gefallenen Freundinnen und Freunde, mit denen sich Elli auf das Abenteuer einlässt, eine Kabarettgruppe namens „Jazz“ zu gründen. Das erste selbst geschriebene und gestaltete Programm wird positiv aufgenommen und gut besprochen. Doch zusehends sind immer weniger Zuschauer im Bühnenraum zu sehen. So tritt sie auch gelegentlich in einer stadtbekannten Lesbenbar auf. Und gibt, sobald etwas Geld da ist, dieses freigiebig, den Moment hedonistisch auskostend, aus. Um am Ende von dem so vernünftigen, also bei ihren Künstlerfreunden unbeliebten Robert verlassen zu werden.
Das kommt alles sympathisch daher, mit teils federleichten Dialogen voller gekonnt eingefangener Frechheiten, Witze, Wortgefechte und Bonmots. Einmal mehr erweist sich, auf wie hohem Niveau in den 1920-er Jahren die intelligente deutschsprachige Unterhaltungsliteratur stand, die damals den Vergleich mit der angelsächsischen um keinen Deut scheuen musste. Und wie stark und verheerend der Bruch ab 1933 respektive 1938 war.
Lili Grün gelingen eindringliche, unter die Haut gehende Szenen, der Tod einer Kollegin Ellis etwa, die mit 30 Jahren der Tuberkulose erliegt, ebenso vermag sie überschäumendes Glück überzeugend zu schildern, am Ende beispielsweise ein großes Engagement Ellis. Ihr insbesondere schaut sie in die Seele, die teils sentimental, teils gefühlsecht und dann wieder ganz modisch mondän ist.
Alles ist Jazz ist eine unterhaltsame und lohnende Lektüre. Und ein schönes, mehr als verdienstvolles Fundstück. Künftig dürfte Lili Grün im Regal neben Irmgard Keun („Das kunstseidene Mädchen“) und Gabriele Tergit („Käsebier erobert den Kurfürstendamm“) stehen. Neben den Feuilletons Billy Wilders, Erich Kästners „Fabian“ und den Bänden eines Kurt Tucholsky und Walter Mehring.