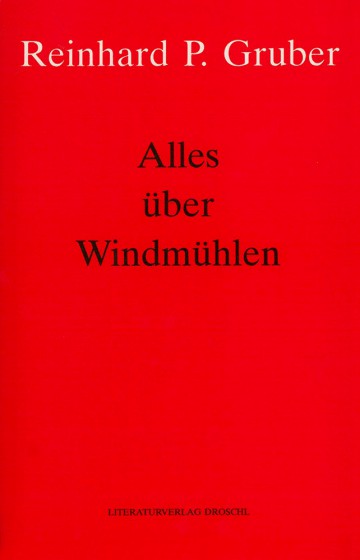Oberflächlich betrachtet, sieht das Buch aus wie eine Dissertation in Kleinschreibung, und es hat auch alles, was dazugehört: Kapitelein- und -unterteilung (von „a“ bis „z“), Fußnoten, Anhänge. Da läßt sich allerhand hineinpressen, warum also nicht auch Windmühlen. In vier Abschnitten – „Windmühlen“, „Winde“, „Landschaften“, „Mensch und Windmühle“ – wird allerhand Wissenswertes und scheinbar Neues erläutert. Die Einleitung zählt auf, was bisher über Windmühlen bekannt ist. Und die Appendices 1-3 bieten Lexikalisches.
So mag man vielleicht eine Rezension eines wissenschaftlichen Werkes angehen. Dann wäre man aber auf den Autor hereingefallen. Denn schon die ersten Sätze des Vorworts zeigen an, wo es langgeht: „die hinterseite der windmühle wird auch mit wind beliefert. sodann ist ihre funktion ungewiß.“ (S. 11) Es geht also um die Windmühle, von allen Seiten betrachtet. Nur, zu welchem Zweck? Der formale Plan des Buches wird von seiner Sprache unterlaufen. Da sind zum einen einfache Sätze, in die hauptsächlich aus der Philosophie – Gruber hat Philosophie und Theologie studiert – stammende Reizwörter eingeschmuggelt sind. Und dann finden sich Satzkonstruktionen, die in ihrer bemühten Umständlichkeit Kennzeichen wissenschaftlicher Fachliteratur sind. Gruber entstellt diese Schreibweise zur Kenntlichkeit: „wenn die windmühlenflügel nicht mehr zu einer bestimmten seite der windmühle zugerechnet werden können, muß von einer unsachgemäßen partialtechnisierung die rede sein, die das natürliche gleichgewicht von dynamik und statik zugunsten ersterer aufzuheben imstande ist, es tatsächlich aufhebt.“
(S. 47)
Die Windmühlen geben, so scheint es, den Vorwand ab für eine listige Art der Sprachkritik. Denn der wissenschaftliche Jargon wird durch die phasenweise zum Schreien komische, bitterernst vorgetragene Sprache als hohles Geplänkel entlarvt. Die kleinste Windmühlenkleinigkeit wird durch das Pathos ihrer Formulierung zu einer Großartigkeit gemacht. Besonders komisch – und auch für Uneingeweihte verständlich – ist in diesem Zusammenhang das „capitel y)“: „die abendländische windmühlenphilosophie: heidegger“
(S. 91ff.), in dem Martin Heideggers Eigentlichkeitsjargon genüßlich übertrieben wird.
Eine Geschichte wird nicht erzählt. Es werden vielmehr Windmühlenaspekte sprachlich gestaltet. Daher kann man das Buch auch nicht nacherzählen. Es eignet sich aber hervorragend zum Zitieren aus dem Zusammenhang, etwas, das in den Wissenschaften verpönt ist. „die windlose landschaft muß als abstraktion bezeichnet werden“ (S. 71), ist nur einer von vielen aphoristischen Sätzen. Doch wer glaubt, dieses Buch würde sich darin erschöpfen, geht fehl. Der satirisch angesprochene enzyklopädische Charakter, der in den Buchstaben des Alphabets, die den 26 „capiteln“ vorangestellt sind, seinen Ausdruck findet, und die subversive Ironie im Gebrauch des wissenschaftlichen Gestus bereiten ein ebenso großes Lesevergnügen. Vieles in Alles über Windmühlen weist voraus auf den Reinhard P. Gruber des „Hödlmoser“ oder von „Nie wieder Arbeit“.
Das Buch ist eine Hommage an die wohl bekannteste Donquichotterie. Nicht umsonst ist gleich das „cap. a)“ Don Quichottes Windmühlenabenteuer gewidmet. Die Windmühle als Metapher des literarischen Kampfes. Cervantes – „m. cervantes“ – übertreibend, kämpft Gruber mit der versprachlichten Windmühle. Und er tut das souverän und unterhaltsam. Das Kapitel endet mit „bravo, cerv.!“ Was den Windmühlenessay Grubers angeht, so möchte man sich diesem Ruf anschließen.