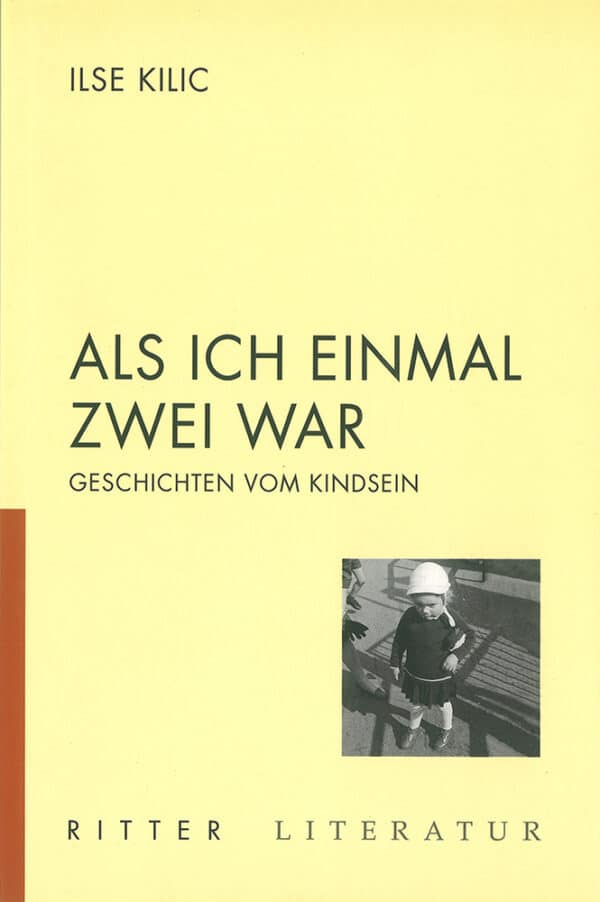Aber so hoch, wie sich etwa Handke in hehrer Tradition die Latte gelegt hat, setzt Ilse Kilic in ihrem Buch Als ich einmal zwei war nicht an. Ihre „Geschichten vom Kindsein“, so der Untertitel, sind genau genommen auch Geschichten vom Erwachsenwerden. Und dies unter den Vorzeichen einer, um mit Gabriel Loidolt zu sprechen, „außernormalen“ Persönlichkeitsstruktur. Kilic führt in die Besonderheit ihrer kindlichen Ich-Figur ganz nüchtern ein: „als ich klein war, hatte ich eine zwillingsschwester. sie sah aus wie ich. aber niemand konnte sie sehen. sie versteckte sich nämlich meistens in mir. oder ich versteckte mich in ihr. dann konnte mich niemand sehen!“ (S. 11)
Die Verdoppelung dieses Ich in „ich“ und „E.“ (so die Abkürzung der unsichtbaren „zwillingsschwester“) wird in den Episoden aus der Sicht des Kindes mit der größten Selbstverständlichkeit beschrieben. Derart herkömmlich wird den LeserInnen dieses doppelte Lottchen in Personalunion nahe gebracht, daß man regelrecht selbst erschrickt, wenn die Protagonistin in einer späteren Episode das schulpsychologische Zeugnis der Volksschule entdeckt, das ihr akute Suizidgefahr prophezeite. „fassungslos stand ich vor dem zettel. das mußte ja ziemlich schlimm gewesen sein mit mir! oder war ich damals noch E.? oder war E. ich?“
(S. 46)
Der Bogen der von Kilic in kurzen, pointierten Episoden beschriebenen Entwicklung der Protagonistin spannt sich von frühesten Erinnerungen des Vorschulalters bis zur Adoleszenz. Kilic erzählt in chronologischer Abfolge in mehreren Stationen von Erlebnissen, die zum Aufwachsen ihres „ich“ gehören, unter anderem von Weihnachtswünschen, Außenseitertum in der Volksschule, von Schuldgefühlen bei Puppenkreuzigungs-Spielen und erster Schwärmerei. Die Texte sind an einer kindlich einfachen Sprache orientiert, die aber nicht gekünstelt kindlich wirkt. Im Lauf des Buches gewinnt die Sprache unmerklich an Komplexität, bis im Epilog schließlich Überlegungen wiedergegeben werden, denen man nicht mehr so ohne weiteres folgen kann. In den gesamten Text sind zahlreiche comicartige Illustrationen eingearbeitet, diese ebenfalls an kindlicher Strichführung orientiert, jedoch in Wirklichkeit von der Autorin am Computer gefertigt.
Das vom kindlichen Ich anfangs noch mit größter Selbstverständlichkeit gelebte Zweisein wird im Lauf des Buches als zunehmend von inneren Spannungen behaftet geschildert. Dies allerdings unter Weglassung von allem psychologischen Erklärungsbramborium. Der innere Konflikt eskaliert, entlädt sich in Fieberphantasien und massiven Ängsten vor dem „ernft des lebenf“ (S. 16). Der Streit zwischen „ich“ und „E.“ ist auch ein Streit zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. „E.“ könnte als Abkürzung für den Erwachsenenanteil der Protagonistin stehen. Zumindest wird das Kürzel einmal in einer Überschrift so verwendet: „ist ich E.rwachsen?“ (S. 63). Die Spannungen innerhalb der Persönlichkeit werden letztlich intellektuell gemeistert, der Ausweg aus der Überlegung von „ich“, eigentlich nicht mehr zu existieren, sondern von „E.“ okkupiert worden zu sein, besteht in einem Akt jugendlicher Gehirnakrobatik: „schließlich aber erkannte ich: auch wenn E. ich war, war ich ich, weil ich dann zwar E. war, aber E. sowieso ich war.“
(S. 64).
Der unvermeidliche Abschied des „ich“ von „E.“ am Ende des Weges von der doppelten kindlichen zur einfachen erwachsenen Persönlichkeit wird letztlich auch als wehmütig empfunden. Aber nicht nur von „ich“, sondern auch von den LeserInnen: Ilse Kilics „Als ich einmal zwei war“ ist eine sympathisch-nüchtern erzählte Kindheitsgeschichte zum Immer-wieder-lesen.