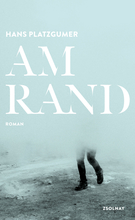Am Rand erzählt vom missglückten Leben, dem Tod und dem Kontrollverlust. Hans Platzgumer ist Musiker, Komponist, Produzent und Autor – ebenso wie der Ich-Erzähler: „Hundert weiße Seiten stehen mir zur Verfügung. Mit schwarzem Kugelschreiber schreibe ich Datum und Namen, Gerold Ebner, auf die erste Seite.“
Gerold Ebner stammt aus einer Südtirolersiedlung in Westösterreich, gebaut in den Vierziger Jahren für Südtiroler Optanten, seine Mutter floh als Teenager aus Glurns im Vinschgau zu Verwandten in diese Siedlung. Der Bub wächst dort weitgehend unbeaufsichtigt und als Fremder auf, aus dem Nirgends-Dazugehören will sich keine neue Identität ergeben. Das Leben am Land? Alles andere als eine Idylle. Der Heimatort der Mutter, den der Erzähler erst als Erwachsener besucht, wird bewohnt von versteinerten Gesichtern: „Zerfurcht und ausgetrocknet wie die hochalpine Felsenwelt […].“ Die Nachbarn in der Siedlung kommen vom Balkan und aus Anatolien. Unproblematisch ist das Verhältnis zwischen den Nationalitäten nicht: Auf allen Seiten finden sich Banden, die ihre Reviere mit Gewalt verteidigen. Auch Gerold ist Bandenmitglied – und Kampfsportler. Mit seinem besten Freund Guido trainiert er Karate. Sie spielen, kämpfen und überleben mit viel Glück die Jugend gemeinsam.
Bereits in seiner Jugend kehrt der Tod in Gerolds Leben ein. Der Anführer der konkurrierenden „Merano-Bande“ stirbt bei einer Mutprobe. Wenige Jahre später findet Gerolds tyrannischer Großvater auch den Tod – durch Gerolds Hände: „Plötzlich schlug er die Augen auf. Er versuchte zu schreien, doch durch das Handtuch drangen nur erbärmlich dumpfe Geräusche. Er winselte, flehte mit allem, was ihm blieb, versuchte, mich abzuwehren, zitterte bis in die Zehen. Ungläubig starrten seine dunklen Augen mich an.“ Später trifft er seinen Jugendfreund Guido, der durch einen Arbeitsunfall zum Pflegefall geworden ist. Der einstige Karateka ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Er will nicht mehr leben. Gerold hilft ihm: „Ich drücke zu, so fest ich kann. Guido hilft mit, seinen ganzen Willen wendet er auf, um sich den Atmungsreflexen zu widersetzen. Ich spüre, wie er mitarbeitet.“ Er tötet seinen Freund – aus Mitleid. Schließlich kommt es in Gerolds Beziehung mit Elena zu einer Wende, die ihn an den Rand bringt.
Hans Platzgumer zeichnet mit Gerold Ebner ein Leben ohne Perspektiven nach. Verluste reihen sich an Verluste. Der erfolglose Autor wehrt sich keineswegs, vielmehr gibt er sich ihnen hin. Sie sind Naturgesetze, denen er sich unterordnet: „In alles wurde ich marionettenhaft verwickelt, konnte bloß noch reagieren, nie über mein Schicksal regieren.“ Diesen Eindruck unterstreicht die lakonische, nüchterne Sprache Platzgumers: „Es war leichter, Guido zu töten als Großvater, obwohl sie beide todkrank waren und Guido der Jüngere. Wohl weil er mithalf, war es leichter. Vielleicht aber auch, weil es mein zweites Mal war.“
Ausbruchsversuche mittels Individualismus erweisen sich als wenig gewinnbringend. Dabei bezieht Platzgumer seine eigene Lebensgeschichte am Rande mit ein, indem er von einem Hans Platzgumer und dessen Reise in die USA berichtet. Gerold will über seinen Freund schreiben – hat aber eine Blockade. Und so lässt Platzgumer den kühlen, rationalen Gerold zum ersten Mal so etwas wie Zweifel spüren: „Ich verlor den Überblick. Irgendwann war es mir unmöglich, dem Teufelskreis zu entkommen, in den ich geraten war. Nichts als die Angst vor dem erneuten Scheitern blieb. Sie hatte sich über den gesamten Text ausgebreitet, war die einzige Konstante geworden, die ihn durchzog. Lange gestand ich mir die Niederlage nicht ein, aber ein zweites Mal war mir das literarische Schaffen unwiederbringlich entglitten.“
Am Rand ist mehr als ein bloßer Lebensbericht. Platzgumer konfrontiert den Leser mit existenziellen Fragen: Gibt es so etwas wie ein gelungenes Leben? Was zählt der individuelle Wille? Und wer entscheidet, wann man aus dem Leben geht? Der Autor gibt keine endgültigen Antworten, aber er zwingt zum Nachdenken. Würde oder könnte man so handeln wie Gerold? So ist Gerolds Frage zu Beginn des Romans zu verstehen: „Spüren Sie den Drang, der Sie hinabzieht?“ Wie würde man selbst im Angesicht des Unheils reagieren?