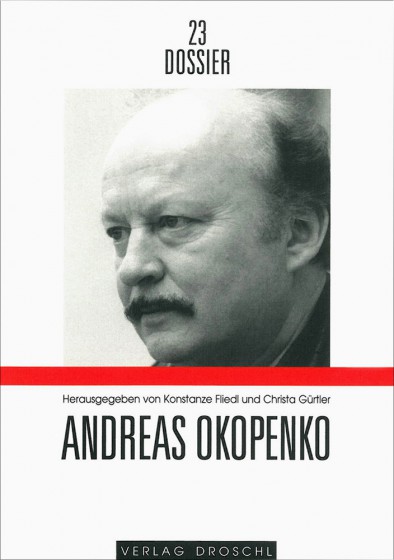Was die beiden Herausgeberinnen Konstanze Fliedl und Christa Gürtler nun als Dossier Nummer 23 vorlegen, ist dafür – selbst gemessen an den beachtlichen Ansprüchen dieser Reihe – eine besonders geglückte Zusammenstellung geworden. Das beginnt schon beim Interview der beiden Germanistinnen, das, den Konventionen der Reihe folgend, den Band eröffnet. Dass das Gespräch nicht unbedingt leicht zu führen war, ist zwischen den Zeilen unschwer herauszulesen, dass ihm trotzdem Einiges zu entnehmen ist, daher eine beachtliche Leistung. Zum Beispiel die sehr vorsichtigen Äußerungen Okopenkos zur Vorbildfrage was Autoren wie Doderer oder Musil betrifft. Bekannt ist, dass Okopenko trotz seines „Lexikon-Romans“ (1970), der 1998 als „Elektronischer Lexikon-Roman“ realisiert wurde, den Neuen Medien fern geblieben ist. Trotzdem ist der „Lexikon-Roman“ mitunter fälschlich als eine Art Vorwegnahme von hypertextuellen Strukturen gelesen worden. Natürlich ist ein Lexikon-Roman wie ein Lexikon selbst und wie andere traditionelle Verweissystem der Buchkultur (etwa die Fußnote) als Hypertext gut realisierbar, was aber nichts anderes aussagt, als dass die neue Technologie auf Konventionen der Buchwelt zurückgreift. Aber das ist wohl eine Debatte, die ganz generell mit dem wenig differenzierten Blick auf die Neuen Medien zu tun hat und weit über Okopenko hinausgreift.
Was dem Band sehr gut tut, ist der fast durchgängige Verzicht auf Erinnerungstexte von Zeitgenossen, die bei entprechenden Anlässen gerne leicht variiert wieder auftauchen. Davor ist ja auch Okopenko selbst nicht gefeit. Er hat sich so oft und so gründlich systematisch über die Situation der „Jungen“ in den 1950er Jahren geäußert, dass feste Bilder und wohl auch Schablonen entstanden sind, die über die Jahrzehnte die Tendenz zur Verselbständigung ausbilden. Die hier aufgenommenen Beiträge sind aber durchgängig originell und informativ. Das beginnt mit Heidi Patakis Porträt des Autors aus dem Jahr 1971, das mit der überraschenden Feststellung eröffnet: „Die Kritik an Okopenko trifft 7 auf 1 Streich“ (S. 25); inspirativ auch Otto Breichas Analyse der wohntechnischen „Randlagen“, die Okopenko als „Protokollant der eigenen Widerstände“ zu entsprechen scheinen. Ein eigenes Beobachtungsfeld eröffnen die beiden Preisreden von Adolf Haslinger aus dem Jahr 1984 und Konstanze Fliedl aus dem Jahr 2002: Darin zeigt sich auch eine Entwicklung der Laudatorenprosa von der philologischen Bemühtheit zur spritzigen Hommage, die den Autor in den Mittelpunkt stellt.
Erstaunlich bedächtig ist demgegenüber der erste Beitrag des Essay-Teils von Klaus Nüchtern aus dem Jahr 1999, der dafür mit Anekdotischem über das Verhältnis zu berühmten Schrifstellerkollegen wie Peter Handke und Thomas Bernhard aufwartet. Wer eine gediegene Einführung in die „semantischen Störpotentiale“ von Okopenkos Lyrik sucht, ist mit dem Beitrag von Wendelin Schmidt-Dengler gut bedient. Daniela Strigl liest Okopenko in „apokrypher Verwandschaft“ zu Peter Altenberg und Theodor Kramer; sehr schön und nah an den Texten auch der Beitrag von Herbert J. Wimmer. Klaus Kastberger untersucht die Entstehung des Romans „Kindernazi“ aus der Sicht des Archivars, für den die vorbildliche Ordentlichkeit in Okopenkos Unterlagen einen erfreulichen Sonderfall darstellt. Alles belegt und sinnvoll vereint, und für schwer Zuordenbares erfindet Okopenko flux die schöne Bezeichnung der „Streusel“-Mappe. Der vorbildliche Ordnungssinn war schon aus Okopenkos Neigung zur Durchnumerierung der literarischen Gruppierungen der 1950er Jahre zu erraten, und wer je Okopenkos Konvolut zur ersten Werkausgabe Hertha Kräftners in Händen hielt, weiss, wie das Arbeitsmaterial philologisch sorgfältigen Arbeitens auszusehen hat.
Das vierte Kapitel versammelt wie üblich ausgewählte Rezensionen. Am interessantesten hier vielleicht jene aus der Frühzeit, die von Dichterkollegen stammen und schon eine gewisse Patina angesetzt haben; etwa von Walter Buchebener (1963) oder Wieland Schmied, der – im Jahr 1958 – mit der bemerkenswerten Überlegung schließt: „Wäre er [Okopenko] siebzehn; und wäre er ein Mädchen; und wäre er Französin – er würde rasch berühmt. Das Publikum unserer Zeit hat am außerordentlichen Gedicht nicht genug: es verlangt die außerordentliche Lebenssituation des Künstlers. Aber mit der kann Okopenko nicht dienen.“ (S. 146f) Trotzdem hat es Okopenko bereits sehr früh auch ins deutsche Feuilleton – in die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (1967) oder dem „Münchner Merkur“ (1969) – geschafft, wie die abgedruckten Rezensionen zeigen. Hervorzuheben wäre vielleicht noch Hermann Schlössers Hommage an Okopenkos „Lockergedichte“, die „selbst mit den besten Pissoir-Sprüchen der Welt den Vergleich nicht zu scheuen“ (S. 186) brauchen (was den Erfahrungshorizont der weiblichen Kollegenschaft eindeutig übersteigt); einen guten Überblick vermitteln die beiden abschließenden Rezensionen zu Okopenkos gesammelter Lyrik und Essayistik von Christiane Zintzen und Leopold Federmair.
Zum kurz gehaltenen fünften Abschnitt „Vita“ bietet sich ein Nachtrag aus Okopenkos jüngstem Band „Streichelzoo“ an: „Trauriges Märchen. Ich war einmal.“ Aber dieser Band mit neuen „Spontangedichten“ lag den Herausgeberinnen wohl noch nicht vor. Nicht unerwähnt bleiben soll die sorgfältige, fast 40seitige Bibliografie, die Theresia Klugsberger zusammengestellt hat – auch um daran zu erinnern, dass der immer am schwierigsten zu erarbeitende Grundstein späterer Bibliografien für viele österreichische Gegenwartsautorinnen und -autoren in der verdienstvollen Dossier-Reihe gelegt wird.