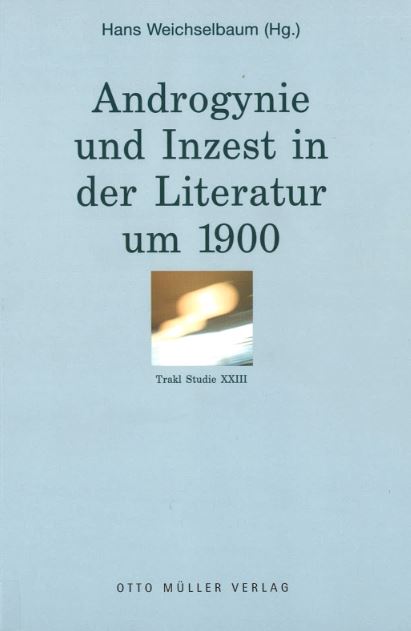Immer noch stehen Expertenmeinungen gegeneinander – und das, obwohl es nur ein einziges Zeugnis gibt, mit dem sich die ‚unerhörte Begebenheit‘ belegen ließe, nämlich ein Brief Ludwig von Fickers an Werner Mayknecht aus dem Jahr 1934, viele Jahre nach Trakls Tod, in dem er von Trakls „erlebter Schuld und erlittener Verzweiflung“ spricht. Die Debatte darüber, wie diese Zeilen zu interpretieren seien, wurde in den vergangenen Jahrzehnten bisweilen heftig geführt. Heute ist man moderater, sichtet die Quellen nüchterner. Insofern ist dieser Band, Ergebnis einer Salzburger Tagung aus dem Jahr 2003, Ausdruck von beidem: der Abgeklärtheit der Forschenden und der unverminderten Lust am Thema.
Zur Diskussion versammelt hatte sich die alte Garde der Traklforschung, darunter Alfred Doppler, Adrien Fink, Walter Methlagl; aber auch junge Namen tauchen auf wie Herwig Gottwald oder Anja Schoene, die zusammen mit weiteren Kollegen das faszinierende Feld von Androgynie und Inzest in der Literatur um 1900 absteckten: so Heinz Wetzel mit Spiel, Liebe und Androgynie bei Else Lasker-Schüler, Jaak De Vos mit Androgynie als ‚coincidenta oppositorum‘ im ethisch-religiösen Spannungsfeld bei Hans Kaltneker, Anja Schoene wandte sich Figuren und Modellen der Androgynie- und Inzestthematik bei Lou Andreas-Salomé und Sigmund Freud zu, Gerhard Neumann Robert Musils Theorie der Liebe, schließlich Herwig Gottwald, der dem Thema Androgynie und Inzest bei Richard Wagner und Thomas Mann nachging. Gerade weil viele der bekannten Positionen ihre bekannten Fürsprecher fanden, ist es zu begrüßen, dass der Herausgeber Hans Weichselbaum es unternahm, die Fakten zu sortieren: kein einziges, eindeutiges Zeugnis von Trakl oder seiner Schwester gibt es, das den Geschwister-Inzest wirklich belegen könnte, dafür viele Anzeichen für Rollenspiele und Lese-Reminiszenzen des Dichters, kulturelle Muster und Gegenbriefe. „Fickers immer wieder zitierte Interpretation“, so Hans Weichselbaum, „war bestimmend für eine fragwürdige Annahme, die sich zu unrecht zu einem in der Öffentlichkeit fraglos hingenommenen Faktum verfestigt hat“; und wenn von ‚Geheimnissen in der Familie‘ gesprochen wurde, „so gab es jedenfalls eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten als das Geschwisterverhältnis Georg-Grete“. Aufklärung (z.B. was die Rolle Buschbecks betrifft) und Objektivität tun also not. Umso glücklicher die Entscheidung des Herausgebers, (teils unbekannte) Briefe der Schwester zu veröffentlichen, die zeigen, welch problematische Persönlichkeit Gretl gewesen sein muss (was die Deutung des Ficker-Briefes in ein anderes Licht rückt).
Neben diesem nötigen Blick aufs Detail nehmen Fragen zur Rolle der Sexualität um 1900 einen zentralen Platz in der Diskussion der einzelnen Beiträger ein. Walter Methlagl sieht – vor allem wenn man den Kontext „Brenner“ fokussiert – ein „kulturgeschichtliches Szenario“ am Werk, das um die Jahrhundertwende mit Androgynie und Inzest durchgespielt wurde; ein durchaus traditionelles, noch älteres Szenario, wenn man die Ein- und Anbindung der Sexualität ans Religiöse bedenkt (so Alfred Doppler mit Hinweis auf Brentanos und Novalis‘ Sexualmystik); ein Szenario auch im Hinblick auf die französische Décadence-Literatur, deren Spuren Adrien Finck in Trakls „Abendländischem Lied“ verfolgt. Das alles rückt Inzest und Androgynie in einen geschichtlichen, literaturgeschichtlichen, jedenfalls weit über die (angebliche) persönliche Verfehlung Trakls hinausreichenden Kontext. Man hatte Lust an ‚abnormer‘ Sexualität, wobei die ‚Lust‘ vor allem Gedankenlust, Leselust war. Man muss daher von einer Verallgemeinerung, ‚Fiktionalisierung‘ des Inzest zum Motiv ausgehen. Georg Trakl, so Walter Methlagl, habe „dieser ‚Welt‘ der Tabus, der Verdrängung der eigentlichen Antriebe, aus denen heraus man den Menschen, den man eigentlich liebt, zur Ware degradiert […] seine enttabuisierende poetische ‚Welt‘ der Geschwisterliebe und Androgynie, diese von ihm selbst tief erlittene Blasphemie, entgegengehalten“.
Dass die Forschung heute eher diese Kunstwelt betont, statt von der Frage nach der realen Verankerung von Dichtung auszugehen, macht nicht zuletzt der Beitrag Gerhard Neumanns klar, der die Linie von den Liebesgeschichten in der Literatur als Ausdruck ihrer selbst, zu den Liebesgeschichten als Träger einer „Kulturtheorie der Liebe“ nachzeichnet – am Beispiel Robert Musils, in dessen „Mann ohne Eigenschaften“ die „zusammenwachsenden Zwillinge“ ja Utopien, Figur-gewordene Möglichkeitswelten verkörpern. Androgynie und Inzest stehen dann für ein Mischungsphänomen, das zugleich physisch und rhetorisch gelesen und nur im Kontext des gesamten Werks verstanden werden kann, nämlich: „Wie ein Gefühl entsteht“.
Unterstützung erhält dieser Ansatz auch von ganz anderer Seite, nämlich durch Jaak De Vos, der das Werk des weitgehend unbekannten Autors Hans Kaltnecker, einem Zeitgenossen Trakls untersucht. Auch in den Liebesszenen seiner Texte lässt sich eine Mischung aus vitalem Exotismus und morbider Dekadenz feststellen, so dass sich der Verfasser zurecht fragt, ob die Spiritualisierung des Biologischen wirklich immer mit dem Etikett des ‚Katholischen‘, wie es die frühe Trakl-Rezeption tat, zu versehen sei. Schließlich hat der Inzest in der Literatur einen anderen Status, eine andere Wertigkeit als der Inzest in mythologischen Erzählungen: Er ist von vornherein Zitat, ein Spiel mit Zeichen, Intertexten, worauf einmal mehr der Beitrag von Herwig Gottwald zu Wagner und Thomas Mann verweist. An der Brisanz für Trakl änderte die Tatsache ‚bloßer‘ Gedankenschuld nichts: Heinz Wetzels Überlegungen zu Trakls Verbindung zu Else Lasker-Schüler zeigen, dass, gerade weil die Religiosität das Verbindende beider Dichter gewesen ist, Trakl sein Spiel mit Blasphemien umso verheerender erfahren haben dürfte.