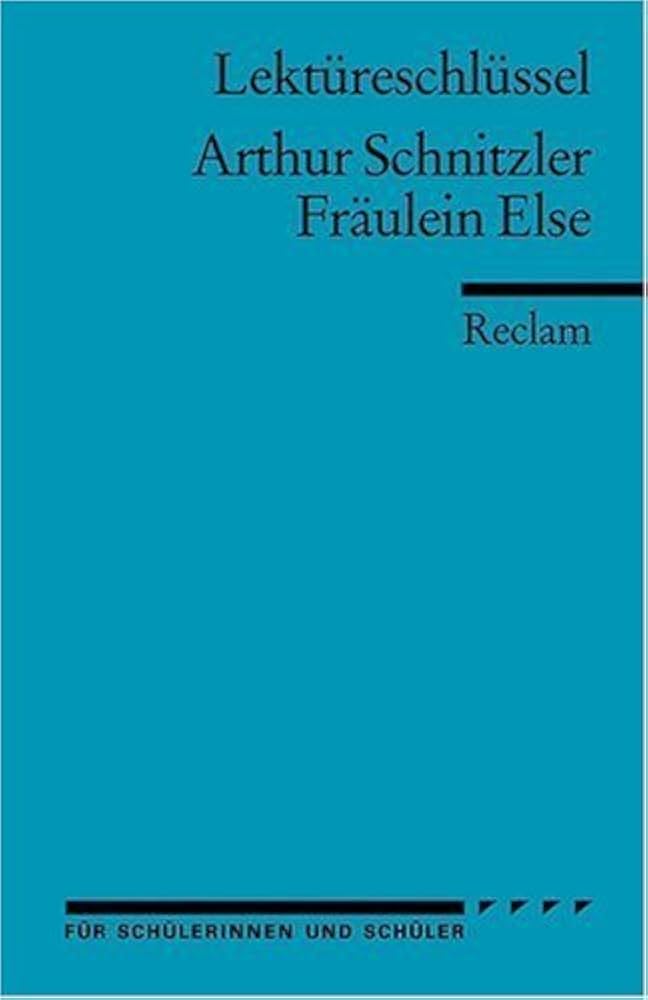Doch das Einleitungskapitel prescht nicht nur begrifflich schnell vor: Der Blick des Autors für „die ‚weibliche‘ Sichtweise in Bezug auf Erziehung, Moral, Sexualität und Gesellschaft“ (S. 6) sei durch persönliche Erfahrungen mit problematischen Frauenfiguren, vor allem mit seiner 15-jährigen Tochter Lili geschärft worden. Es folgen Hinweise zur Rezeption und ein kurzes Fazit, mit dem man in die weitere Lektüre entlassen wird: Es scheint zwar fraglich, ob sich ein junges Mädchen heute noch so quälen würde, doch ist der Text eine „nachvollziehbare Darstellung des Selbstfindungsprozesses eines jungen Menschen in einer gesellschaftlich und moralisch fragilen Umwelt“ (S. 7).
Muss das alles schon vor der Lektüre so festgeschrieben werden? Kann es sich nicht auch um einen Prozess des Selbstverlustes handeln und vor allem: Ist der Autor eines Lektüreschlüssels gut beraten, Schülerinnen und Schülern vorzuschreiben, was nachvollziehbar ist und was nicht? Diese Frage stellt sich öfter, wenn Heizmann dem Text gegenüber enthusiastisch agiert. Schnitzlers „Meisterschaft in der Verwendung sprachlicher Andeutungen“ (S. 41) festzuhalten ist sicher wichtig, und dass der Text „nicht nur ein scharfsichtiges Charakterbild, sondern auch eine dekuvrierende Analyse der Gesellschaft um die Jahrhundertwende“ (S. 46) ist, kann als historische Tatsache ins Treffen geführt werden – doch allzu viel Heldenverehrung vermindert die kritische Distanz, die Synthese – erzwungen auch vom Format des Lektüreschlüssels – schadet der Textanalyse. Wenn es dann etwa heißt, Elses zwiespältige aber stets ehrliche Gedanken würden „wohl kaum einen Leser kalt lassen, gleichgültig, ob er mitfühlend oder kopfschüttelnd auf sie reagiert“ (S. 30), dann hebt das Widersprüche, sowohl des Erzählverhaltens als auch des Lektüreerlebens, allzu leicht auf. Da werden Schülerinnen und Schüler jovial bei der Hand genommen: sie dürfen sich ihren Teil dazu denken – aber emotional angegriffen von dem großartigen Text haben sie jedenfalls zu sein.
Vor lauter Synthese kommt die Analyse mitunter zu kurz. Dabei wäre es gerade die Herausforderung, der spezifischen Erzählweise und den Fragen, die sie aufwirft, nahe am Text nachzugehen. Den Ansatz verfolgt Heizmann, wenn er sich bei der Wiedergabe des Inhalts am Verfahren des Textes orientiert und etwa beginnt: „Else liest den Brief mit Verbitterung. Ihr geht es durch den Sinn, dass die Familie eigentlich schon seit Jahren am Ende ist“ (S. 9). So macht er die Dinge als Lektüre, Gedanken etc. erkennbar. Sobald er zur besseren Zusammenfassung von diesem Verfahren abweicht, tritt die ganze Problematik der Erzählweise zutage: Über Else erfahren wir, unbegründet, man „wird sie sich als attraktive junge Frau denken können“ (S. 15), und über Elses abschätzige Stellungnahmen zu ihrer Mutter: „Diese […] Aussage charakterisiert die Mutter wohl recht gut, auch wenn sie sich sehr hart anhört.“ (S. 23) Hier nimmt sich der Interpret heraus, einzelne Teile der Erzählung nicht nur zusammenzufassen, sondern zu qualifizieren. Und genauso wie über die Mutter, richtet er auch über die Tochter. Elses wiederholte Aussage, sie wäre zu feig, rückte er entschieden zurecht, denn „dieser Begriff passt eigentlich nicht, denn sie ist einfach zu labil, den starken seelischen Belastungen standzuhalten“ (S. 19). Wenn es um den Charakter der Mutter oder die hier erwähnten Belastungen geht, glaubt der Interpret Else, ansonsten ist er gescheiter als sie. Und wo beides nicht mehr möglich ist, weil die spezifische Erzählweise keine Klärung erlaubt, weist er nicht auf genau diesen Umstand hin, vermittelt er nicht Lektürefähigkeiten und wie man mit der besonderen Art, wie ein Text Informationen vermittelt, umgeht, sondern verfällt in unbegründete Spekulationen: „Ob ihn [Dorsday] echte Besorgnis und Anteilnahme in das Zimmer der für ohnmächtig geltenden Else führt, lässt sich nicht sicher sagen; wahrscheinlicher ist aber, dass ihn pure Neugier angetrieben hat.“ (S. 21)
Dieser Umgang mit der Erzähltechnik wirkt direkt in die Interpretation. Was bedeutet es etwa, „dass dieser Erzählstil Elses Geschichte einen hohen Grad an Realitätsnähe verleiht“ (S. 40)? Die erzählten Ereignisse werden durch den Stil noch lange nicht real, und wozu der Stil der Erzählung ein Naheverhältnis hat, ist durch solche Verwendung der Begriffe nicht mehr zu sagen. So halten weder die Zusammenfassungen der Inhalte – der „18-jährigen Else“ (S. 5) steht die Titelfigur „als ein neunzehnjähriges Mädchen“ (S. 8) gegenüber – noch die Interpretationsansätze. Mitten in Schnitzlers Biografie schummelt sich etwa eine neue Deutung: Der Autor hätte doch nicht, wie in der Einleitung erwähnt, die pubertären Stimmungsschwankungen seiner Tochter dargestellt, „eher dürfte Schnitzler an Stephi Bachrach gedacht haben. Der Autor selbst hat sich jedoch immer gegen solche allzu einseitigen Bezugnahmen gewehrt.“ (S. 61) Die Selbstinterpretation des Autors wird ignoriert, einem an dieser Stelle unbegründeten Biografismus gehuldigt, und das noch mit einem reichlich widersprüchlichen Ergebnis.
Ein Vorbild für die Interpretation in der Schule kann das nicht sein. Denselben Haken hat auch der Interpretationsteil des Bandes. Heizmann erläutert zunächst den Titel und formale Aspekte, dann ausführlich Metaphern und Motive, wobei auf die Bedeutung von Tageszeit und Wetter, auf leitmotivische Begriffe, soziale Determinanten und schließlich ausführlich auf den Themenkomplex „Eros und Thanatos“ eingegangen wird, wo auch eine psychoanalytische Deutung vorgestellt wird. Abschließend liefert der Autor eine Auslegung, warum Elses Todestrieb ihren Lebenstrieb überwiegt: Sie sei möglicherweise das Opfer von frühkindlichem Missbrauch durch den Vater und reagiere deshalb mit Verdrängung, Liebesunfähigkeit und Flucht in eine Traumwelt. Dies ist die einzige Interpretation des Textes, die näher ausgeführt wird und sie erhält durch ihre Stellung am Schluss des Kapitels zusätzliches Gewicht, sie erscheint als letztes Wort. Das mag angehen, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Hier allerdings folgt ein alles relativierender Schlusssatz: „Zwingend notwendig sind diese Folgerungen jedoch nicht.“ (S. 54)
Der Satz verrät das ganze Dilemma des vorliegenden Bandes. Statt zu zeigen, wie aus dem Text auf verschiedene Interpretationen zu schließen ist und welchen Status man diesen dann einräumen muss, tut der Autor mehrmals so, als wären die Informationen beliebig zusammengesucht und als könnte man beliebig Dinge in den Raum stellen, wenn sie nachher als nicht zwingend gekennzeichnet werden. Das verursacht Unbehagen, wenn man an den Schulgebrauch denkt. Und es relativiert die Leistungen des Bandes, der dennoch auf wenig Raum eine Fülle von Informationen bietet. Was über die Struktur des Textes, über die Spannungskurve und das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit gesagt wird, ist mit einfachen Worten gut erklärt, und die kurze Deutung des Titels als Distanzierung durch soziale Differenzierung überzeugt, weil sie den historischen Kontext nicht vergisst. Die Informationen zur Rezeption – vom ‚Skandalschriftsteller‘ bis zu Eyes wide shut (1999) – sind gut aufbereitet und viele der (allerdings mitunter kuriosen) Fragen aus der anschließenden „Checkliste“ sind nach der Lektüre des Bandes schlüssiger zu beantworten.