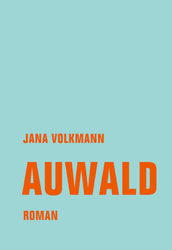Schon zuvor lernte man sie auf Umwegen und Spaziergängen in der näheren Umgebung kennen, weil sie nicht mehr nachhause wollte, wo sie mit ihrer Partnerin Lin lebt. Warum, bleibt unausgesprochen, vielleicht liegt es an der von Judith selbst angenommenen eigenen Distanziertheit, ihrer Unfähigkeit zu wirklicher Nähe und dazu, sich auf jemanden ganz und gar einzulassen, so dass Beziehungen nach einer Weile auslaufen, versanden. Die Oberfläche und Grenze zwischen der Welt und dem Ich der eigenen Haut kann hier ebenso genannt werden wie das sinnbildhafte Holz, das die Tischlerin bearbeitet.
In einer Rückblende lernt man die vorantreibende Bewegung des Romans kennen: hinaus aus der Welt, die eine Party sein kann, auf der jemand nicht auftaucht oder früher geht, Judiths Alltag in Wien oder schließlich, der Aufbruch aus sich heraus, in Richtung totaler Auflösung und Verschwinden. Und bald taucht wie Tschechows Gewehr der „gepackte zweitteuerste Rucksack“ aus dem Bergsteigergeschäft, der alles für ein Leben in der Wildnis oder im Freien enthält, auf. Was macht mich aus? Was braucht man wirklich?
Judith – ganz klassisch für die deutschsprachige Belletristik eher eine miserable Touristin – hat sich entschieden, mit dem Twin City Liner von Wien nach Bratislava zu reisen. Ab 1914 verband die Pressburger Bahn (keine Straßenbahn, wie nostalgisch gerne behauptet wird, sondern eine Lokalbahn) die beiden rund 70 Kilometer voneinander entfernten Städte, die Wiener*innen besuchten gern die berühmte Oper und fuhren dann wieder nachhause (et vice versa).
Das Nahe(liegende) als nahezu Unbekanntes, Nähe und Fremde, Fremdheit, was schließlich durch die andere Sprache verstärkt wird, als Kultur – historisch und in Volkmanns Roman. Umso interessanter erscheint der Rezensentin, dass ein deutscher Kinofilm mit dem programmatischen Titel Freiheit vor wenigen Jahren ebenso Bratislava als Fluchtpunkt für eine rätselhafte Entscheidung gewählt hat, als eine Frau ohne Vorwarnung und erkennbaren Grund, ohne sichtbare Probleme privater oder beruflicher Natur eines Abends ihre Familie verlässt und zuerst in Wien, bald in Bratislava strandet, wo sie mit neuer Identität in den Tag hineinlebt – eine europäische Geschichte oder, wie es auch gelesen wurde – nach dem Literaturtheoretiker Michael Hardt eine in Film übersetzte Ausdehnung des hinlänglich zu eng gedachten Begriffs Liebe? Freiheit und Liebe jedenfalls klingen an in Volkmanns Erzählung, wenn auch eher als etwas, das ebenso verschwindet oder vor dem man sich zurückzieht, flieht, weggeht (letzteres, die Liebe) oder dem man sich vage annähert, wie die Freiheit in einem Naturgebiet, das sich deutlich von der typischen Vegetation seiner Umgebung unterscheidet – das Fremde im Naheliegenden, verbunden und unverbunden gleichzeitig, auch hier wieder.
In einem Museum wird der Protagonistin das Ticket für die Rückfahrt gestohlen, sie ist erleichtert über diesen Zufall, denn nun kann sie sich zu Fuß aufmachen in den Auwald.
Judith verbringt zwar nicht die ganze Zeit in der natürlichen Pflanzengesellschaft der „Harten und Weichen Au“, jenem grünen Band zwischen Bratislava und Wien, übrigens die größte zusammenhängende und ökologisch noch weitgehend intakte und naturnahe Aulandschaft dieser Art in Mitteleuropa, aber sie setzt sich mit dem titelgebenden Auwald doch auseinander – und die Au setzt der Protagonistin auch zu. Zwar kann sie mit Holz, sagt sich Namen von Holzarten zur Beruhigung vor, aber mit der Natur hat sie es so gar nicht … Was Volkmann aber meint, wenn sie schreibt, die „Natur, dachte sie, hat Angst vor mir, sie zittert“, bleibt ebenso ein Rätsel wie das Schiff etwa, dessen Verschwinden eine katastrophische Situation einzuleiten scheint.
Am Beginn des zweiten Teils steht „Ich“, ab hier wird ihr Name nicht mehr genannt, sie gibt alles weg, was auf ihre Identität hinweisen könnte, auch der Mann im Wald, der sie wie nebenbei versorgt, als er sie in seinem Haus auffindet (Brot, Zigaretten), verschwindet, kommt wieder, obgleich ihnen längst die gemeinsame Sprache abhanden gekommen ist. Die Ich-Perspektive wird eingenommen, um so die Auflösung des Ichs signifikanter zu benennen – eine semiotisch und semantisch eigentlich unauflösbare Aufgabe, die sich die Autorin gestellt hat, auch wenn man dem Versuch der Lösung sehr gerne beiwohnt, gerade, wenn die Schilderungen der Landschaft und äußeren Gegenden auch das Innen berühren und begreifen.
Die Ich-Erzählerin tritt schließlich den Weg zurück in die Stadt an, diese ist ausgestorben, apokalyptisch leer, sie sucht ihre alte Gegend auf – und hat die Erinnerung nicht verloren –, sie imaginiert ein letztes Zusammentreffen mit der Frau, die an ihrer Stelle mit dem Schiff nach Wien gefahren und ebensowenig angekommen ist, „meine Diebin“. Als würde sie sich wünschen, dass die Diebin nicht nur den Inhalt ihres Rucksacks stiehlt, sondern auch sie selbst. Der Ort, den sie dabei imaginiert, sind zwei sich berührende Landschaften, die sich fremd und nah zugleich sind, einander bedingen wie die Au und das Umland zwischen Bratislava und Wien und die weit scheinen. Aussichtsreich? Eher beunruhigend, wie auch der Epilog, der suggeriert, dass das Leben weitergeht. Aber wer erzählt uns das? Die wiedergefundene Erzählerin? Eine sich selbst abhanden gekommene, nicht vollständig geleerte Hülle oder doch die auktoriale Erzählstimme vom Anfang? Die alttestamentarische Judith rettete durch die Enthauptung des Holofernes das Volk Israel und damit die Welt, das galt aber nur so lange, wie sie selbst am Leben war und über ihre Identität verfügte.