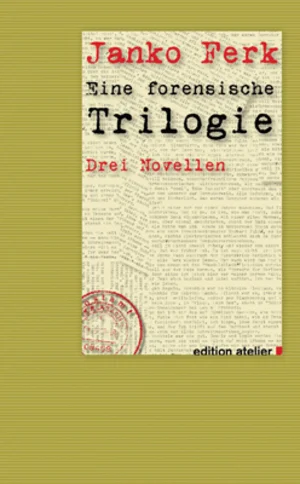„Sehr geehrter Herr Staatsanwalt! Sie haben letzthin behauptet, ich hätte Furcht vor Ihnen. Ich wusste, wie gewöhnlich, in diesem Augenblick keine Antwort.“ (S. 7).
Diesem unvermittelten Beginn – eine Variation auf Franz Kafkas „Brief an den Vater“ – folgt in einer hermetischen Innensicht des Ich-Erzählers die Darstellung seiner Beziehung zum Vater und des misslungenen Versuchs, seine Verlobte F. zu heiraten. Wenngleich K. viele Züge seines Vorbildes Franz aufweist, wenn Gestik, Motivik, Sprache, sogar einzelne Satzkonstruktionen und Worte aus Kafkas autobiographischer Schrift entnommen und hier neu zusammengestellt werden, unterscheidet K. und Franz doch ein wesentliches Moment: K. versucht sich mit der Verteidigungsschrift gegen seine Furcht aufzulehnen, stellt sich dem übermächtigen Staatsanwalt entgegen, Franz kann seinem Vater aus Furcht nicht antworten.
„Liebster Vater, Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wußte Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe, …“ (Franz Kafka, Brief an den Vater).
Der Staatsanwalt wird gerade durch den ausdrücklichen Hinweis, dass er nicht mit dem Vater gleichzusetzen sei, Adressat von K.’s Verteidigungsschrift und zum Stellvertreter für den Vater. Wie bei Kafka vollzieht sich die existenzielle Rechtfertigung durch das Schreiben, die Schrift – Schrift gegen Schrift, Anklage gegen Verteidigung. Das Recht vollzieht sich für K. über die Sprache: „Meine Geschichte und mein Recht sollen nicht an der Sprache scheitern.“ (S. 10). Das Schreiben ist für K., dem das Reden unter der Übermacht des Vaters unmöglich geworden ist, die einzige Möglichkeit, für sich zu sprechen.
Die Sprache, die ihm dafür zur Verfügung steht, ist von Phrasen, Sprichwörtern, klischeehaften Bildern und leeren Metaphern durchsetzt. In ihren unbeholfenen Wendungen und angehäuften Wortvariationen scheint jedoch immer wieder eine objektivierende, exakt juristische Sprache durch. Die Verkürzung der Syntax auf Sentenzen, auf wenige Worte, schließlich auf ein einziges Wort, schränkt den Blickwinkel von K. in diesem langen Monolog, der ohnehin schon eine subjektive Innensicht darstellt, noch weiter ein. In der Anhäufung von Worten versucht K. Halt in der Sprache zu finden, was ihm aber misslingt.
Ähnlich wie Josef K. im „Prozess“ bleibt K. seiner Furcht, der Allmacht des Vaters und dessen forensischem Gegenbild, dem Staatsanwalt, verhaftet. Seine Fluchtversuche, wie die beabsichtigte Heirat, müssen letztlich scheitern, weil die erhoffte Befreiung eine neue „Verhaftung“ bedeuten würde.
Janko Ferk, Richter am Landesgericht Klagenfurt, Schriftsteller und Übersetzer, gelingt mit dieser Novelle eine schriftstellerische Annäherung an Franz Kafka, die seine Kafka-Rezeption, wie sie in der 1999 erschienen Arbeit über Kafkas Rechtsphilosophie dargelegt ist, literarisch ergänzt.