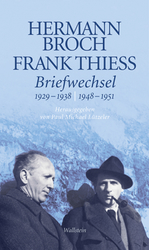Was die beiden Schriftsteller von Anfang an eint, ist eine gewisse wertkonservative Haltung verbunden mit der Suche nach dem „Neuen“ in der Literatur, das zugleich auch als Gefahr und Verlust wahrgenommen wird. Brochs Offenheit ist dabei deutlich stärker ausgeprägt, wie seine Begeisterung für den Ulysses von James Joyce zeigt, dem Thiess eher vorsichtig gegenübersteht.
Dann kommt die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und das macht das Verhältnis der beiden doch schwieriger. Thiess versucht sich zum neuen Regime zu verhalten, zunächst sogar einigermaßen wohlwollend, bald durchaus skeptisch, aber eben doch. Was er jedoch nicht tut, und was ihm Broch nie vergisst, ist den Kontakt mit seinem jüdischen Kollegen in Österreich abzubrechen. Das gibt einer scheinbar rhetorischen Abschiedsformel wie „Mit allen Gefühlen treuer Verbundenheit“ (S. 302) in einem Brief von Frank Thiess vom 18. September 1934, ein besonderes Gewicht. Auch wenn Broch mit der Anbiederung seines Freundes an das neue Regime in Gestalt seines Kriegsromans Tsushima nicht einverstanden ist, der Kontakt bleibt aufrecht und gewinnt in der zunehmenden Vereinsamung beider an Innigkeit. 1937 wechselt man endgültig zum Du. Und 1938 ist es dann Thiess, der das Manuskript von Brochs Bergroman-Fragment nach England schickt und damit rettet. Als Thiess am 22. September 1938 seinen letzten Vorkriegs-Brief an Broch schreibt, hat dieser schon seit zwei Monaten Österreich verlassen.
Nach der Befreiung ist es Thiess, der am 16. Jänner 1948 den schwierigen ersten Brief schreibt, nicht ohne gleich zu Beginn festzuhalten, dass er von den Erlebnissen der vergangenen Jahre nichts erzählen will, da man doch „alles Erdenkliche anstellt, um es zu vergessen“ (S. 447). Thiess Position in der fatalen Auseinandersetzung mit Thomas Mann ist bekannt. Broch verhält sich diplomatisch, verteidigt im Zweifelsfall aber stets Position und Werk Manns. Was für Thiess, der sich mit dieser Debatte einigermaßen desavourt hatte, aber bedeutsam ist: Broch zögert nicht, seinem Freund in einer deutschen und einer amerikanischen Zeitschrift mit einer öffentlichen Erklärung über sein integeres Verhalten ihm gegenüber zu Hilfe zu kommen.
Wie bei allen Editionen Lützelers sind sämtliche Poststücke mit ausführlichen und sorgfältigen Anmerkungen versehen und geben damit einen umfassenden Einblick in das Verhältnis der beiden Schriftsteller und ihre jeweilige Lebenssituation. Eine dieser Anmerkungen aber soll hier ganz am Rande berichtigt werden – auch weil sie eine der wenigen namentlich genannten Autorinnen betrifft, was vielleicht kein Zufall ist. Hermann Broch ärgerte sich 1930 darüber, dass er im Umfeld eines Preisausschreiben des Diederich Verlages „in einem Atem mit Alarich und mit M. Wied in aller Öffentlichkeit sozusagen ‚lobend erwähnt'“ (S. 99) wurde. In der Anmerkung dazu heißt es, Wied habe ihren Roman Rauch über Sanct Florian eingereicht, dessen früherer Titel Das Asyl zum obdachlosen Geist lautete. Doch das sind zwei völlig unabhängige Romane dieser bis heute unterschätzten Autorin.