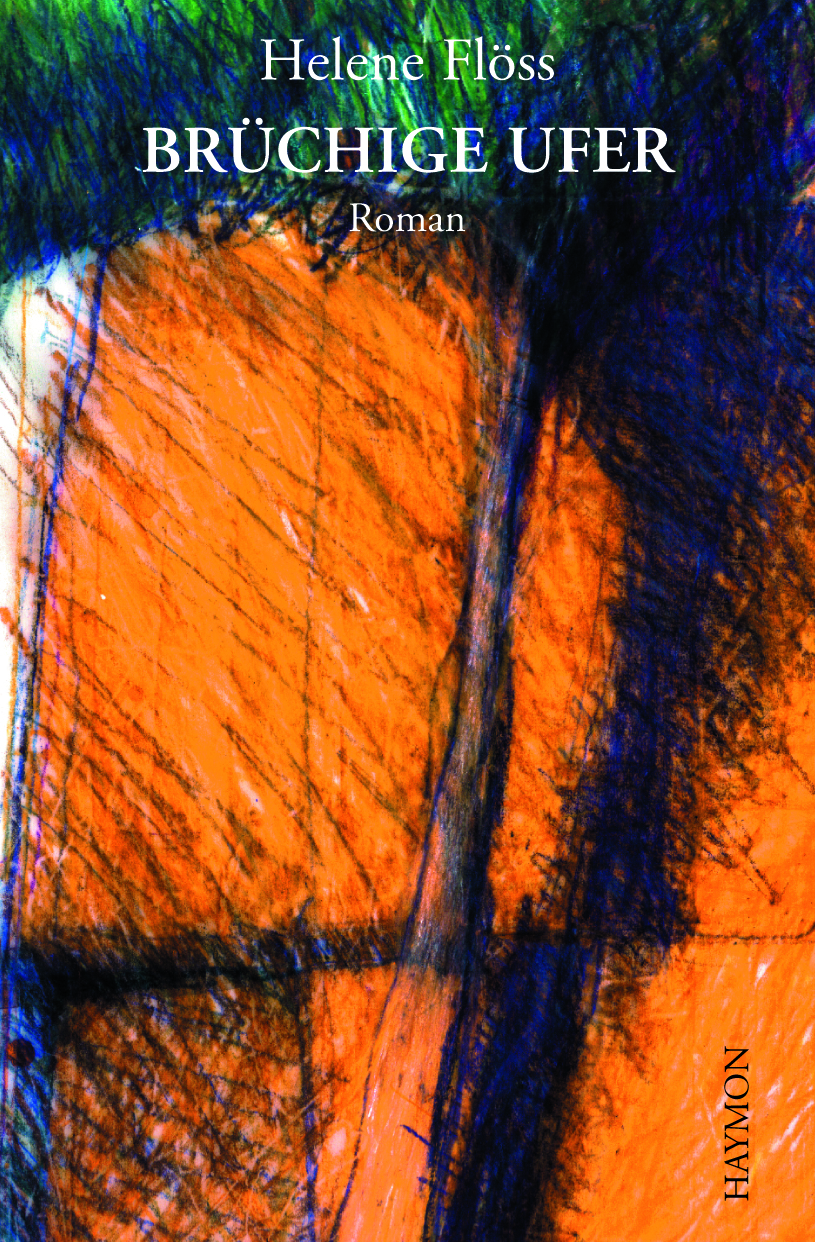Gyula ist die Hauptfigur des Romans Brüchige Ufer, um die sich die Biographien seiner Vorfahren ranken. Das geht zurück bis zu den Großeltern und einer Zeit, als das Burgenland noch ungarisch war. Es ist der Raum zwischen Eisenstadt und Sopron (Ödenburg), den seine Familie und er bewohnen und wenn auch manche der Vorfahren „Zugewanderte“ waren, kamen sie nie von weiter her als aus Güssing. Die Brüder Gyula und Ferenc tragen – vielleicht als Zugeständnis an die vermischte Vergangenheit – ungarische Namen.
Ihr Großvater hätte nicht schlüssig zu antworten gewusst „was er denn sei, Deutscher oder Ungar, er hätte seinen Hut ein Stück zur Seite geschoben und sich darunter ein wenig verlegen gekratzt. Ungar, hätte er wahrscheinlich geantwortet. Vielleicht hätte er aber auch gesagt: Mir redn do deitsch, und der Frager hätte es sich aussuchen können.“ (S. 44) Seine Frau, die Malinka, die als Großmutter „Malinka-Moahm“ hieß und den kleinen Gyula in ihre Obhut nahm, durchlief eine typisch burgenländische Frauenkarriere des beginnenden 20. Jahrhunderts: die erste Stufe trat sie mit sechs auf dem Acker des Gutsherrn zum Unkrautjäten an, die nächste mit acht in der heimischen Zuckerfabrik, dann folgten die Textilfabrik ein paar Dörfer weiter und schließlich die Schokoladefabrik in Wien. Mit neunzehn heiratete sie den Tagelöhner Michael aus Ödenburg, der sich 1905 als Fabrikarbeiter in Amerika verdingte. Mit den hart verdienten Dollars kauften sich die beiden eine kleine Landwirtschaft, aber bevor Michael noch zum Ackern kam, musste er in den Krieg und dieser Krieg war es, der ihm den österreichisch-ungarischen Boden unter den Füßen teilte (siehe Leseprobe). 1922 ging Michael ein zweites Mal nach Amerika und Malinka versorgte die fünf Kinder allein. „Die Malinka hat sich zeitlebens nie gefragt, ob sie glücklich sei.“ (S.67)
Ihr Sohn Mathias, Gyulas Vater, fragte sich das umso mehr. Er war ein ruheloser Mann mit verschiedenen Berufen und einer boshaften Frau. Die Ansprüche dieser vom Zweiten Weltkrieg gezeichneten Generation waren sprunghaft angestiegen, suchte man doch endlich den Anschluss an das moderne Leben. Anders geartet als die Schwiegermutter, gab es für Irma nichts, das ihren Vorstellungen entsprach, außer Gyula, „Meinbub“, den sie besitzergreifend liebte. Die Schläge ihres Ehemannes resultierten aus der nachhaltigen Gehässigkeit, mit der sie diesen quälte. In dieser Atmosphäre wächst Gyula zu einem beziehungsgestörten Erwachsenen heran, dessen fruchtlose Ehen und Liebschaften ihn als Letzten seines Stammes zurücklassen. Der berufliche Erfolg, durch den er sich in die „gute Gesellschaft“ der Landeshauptstadt hocharbeitet, bewahrt ihn nicht vor seelischer Not.
Bis es jedoch zu Gyulas unglücklichem Ende kommt, zeichnet Helene Flöss ein ganzes Panorama burgenländischer Befindlichkeiten an der Grenze zu Ungarn und seiner Beziehung zu Wien. Anhand der Erzählungen über das Wachsen und Werden des Buben geht Helene Flöss jeder einzelnen Biographie, die für Gyulas Leben eine Rolle spielt, detailreich nach. Es gelingt ihr ein Familienpsychogramm zu erstellen, das zugleich auch Rücksicht auf die historischen Umstände nimmt. Die Auswanderungswelle der Burgenländer nach Amerika ist hier ebenso dokumentiert wie die Judenghettos der burgenländischen Kleinstädte oder die Flucht der Frauen und Kinder vor den Russen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Autorin hat sich mit (im Anhang zitierter) Sekundärliteratur versorgt, um ihre Figuren in die Weltgeschichte einzubetten. Sie verquickt das kleine Einzelschicksal mit großen Zeitströmungen – wie sie es bereits in bewährter Weise in ihren Südtirol Romanen bewältigte. Damit kommt sie dem Bedürfnis des Bewahrens von Erinnerungen nach, die mit dem Sterben der uns vorausgehenden Generationen verlorengehen.
Auch die vielen mundartlichen Ausdrücke, die den deutsch-ungarisch-kroatischen Sprachschatz widerspiegeln – im Romantext eingeflochten und hilfreich im Anhang erklärt – sind vom Aussterben betroffen. Die nach Amerika ausgewanderten Männer heißt es „beteten kroatisch, zählten ungarisch, redeten deutsch mit ihren Frauen und englisch mit ihren Kindern.“ (S. 50) So weit muss Gyula nicht weggehen, um sein Kroatisch zu vergessen. Er hat ein anderes Ziel: „Mit rastlos treibendem Fleiß, der fast schon einem Furor glich, eignete er sich an, was ihm an Gelehrtheit und Einsicht zu fehlen schien, in zerquälter Verbissenheit lief er dem Wissen nach, das er zu brauchen vermeinte, mit beharrlicher Strenge verlangte er sich das Aufholen ab und das Ankommen und verlor trotz der Betrübtheit, in der das alles vor sich ging, den Vorsatz nicht aus den Augen, sich nie mehr von einem Vorgesetzten mit verächtlicher Noblesse als kleiner Burgenländer zur Seite lächeln zu lassen.“ (S. 196). Dieses Gefühl des Zurückgesetztseins macht Helene Flöss an Gyulas persönlicher Lebensgeschichte fest, sie hätte es aber getrost als „Burgenländerschicksal“ verallgemeinern können, so wie es das Schicksal des einzigen burgenländischen Bundeskanzlers gewesen ist, als solcher belächelt zu werden.
Dieses Gefühl des Zurückgesetztseins ist der Kern des burgenländischen Lebensgefühls – und das trifft Helene Flöss mit Zielsicherheit – seit das Burgenland als ärmstes Bundesland zu Österreich kam. Dieses Land war immer der Übergangsbereich, aus dem die österreichisch-ungarischen Magnaten ihre Leibeigenen rekrutierten – ein Umstand, der Land, Menschen und Traditionen prägt. So wie Malinka vor hundert und Irma vor fünfzig Jahren sind die burgenländischen Wien-PendlerInnen auch heute noch in der Bundeshauptstadt gerne als willige und billige Arbeitskräfte gesehen. 1995 wurde das Burgenland als EU-Förderland Nummer eins rasant an den wirtschaftlichen Aufschwung angeschlossen, die jahrhundertelange kulturelle Prägung lässt sich jedoch nicht in zehn Jahren wegwischen.
Der Südtirolerin Helene Flöss gebührt Dank für diesen ersten burgenländischen Familienroman – er könnte in ihrer neuen Heimat als literarische Herausforderung angenommen werden.