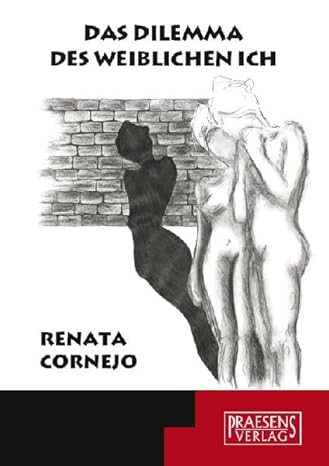Sie fasst zunächst auf sehr kompakte Art und Weise die poststrukturalistischen Positionen der feministischen Theorien in den 1980er Jahren zusammen, die ausgehend von Frankreich die deutschsprachige Diskussion geprägt haben. Hélène Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva plädieren für die Praxis der Differenz, für die Artikulation des Weiblichen als das Verdrängte, Unbewusste und Sprachlose. Die Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz ist dabei das Ziel, der Frau bleibt allerdings der Subjektstatuts weiterhin versagt – so Renata Cornejos Kritik an den vorgestellten Diskursen, in der die theoretischen Weiterentwicklungen in den 1990er Jahren allerdings ausgespart bleiben.
In einem nächsten Schritt analysiert Cornejo das künstlerische Selbstverständnis der Autorinnen Elfriede Jelinek (geboren 1946), Anna Mitgutsch (geboren 1948) und Elisabeth Reichart (geboren 1953), die in ihren Werken die Erfahrungen der „Neuen Frauenbewegung“ reflektieren, ihr „feministisches“ Selbstverständnis aber sehr unterschiedlich formulieren. So versteht sich Elfriede Jelinek als feministische Autorin, lässt für ihre Texte aber nur ästhetische Bewertungen gelten. Auch Anna Mitgutsch definiert sich selbst als überzeugte Feministin, distanziert sich aber von ideologischen Aufbereitungen in der Literatur und vor allem von der Einordnung ihrer Bücher in die Kategorie „Frauenliteratur“ (wohin sie von der Literaturkritik und zuweilen auch von der Literaturwissenschaft gestellt wurden). Wie Elfriede Jelinek verhält sie sich skeptisch und kritisch zu den französischen Feministinnen, eine Haltung, die Elisabeth Reichart teilt. Auch sie wehrt sich gegen eine feministische Etikettierung. Renata Cornejo bezieht in ihre Darstellung zwei Interviews mit ein, die sie mit Anna Mitgutsch (1995) und Elisabeth Reichart (per E-Mail 2002) geführt hat und die im Anhang des Buches dokumentiert sind. Die ästhetischen Verfahrensweisen der untersuchten Autorinnen sind verschieden, gemeinsam ist ihnen jedoch die Verweigerung von Identifikationsmodellen, positiven Utopien und die Rezeption von Ingeborg Bachmann, deren Spuren in ihren Werken Cornejo nachzeichnet. Ingeborg Bachmann ist ein Vorbild, sie ermöglicht für die Autorinnen ein positives Weiterdenken und Weiterschreiben in je unterschiedlicher Akzentuierung.
„Das verstümmelte weibliche Ich lernt sprechen“ betitelt Cornejo das Kapitel über die beiden untersuchten Werke von Elisabeth Reichart, die den Versuch thematisieren, „diejenigen zum Sprechen zu bringen, die zum Schweigen gebracht worden sind: die Mutter Hilde in Februarschatten, die Kampfgenossin der Mutter Anna Zach in Komm über den See.“ (S. 90) Mit Bezug auf Julia Kristeva kann Cornejo darlegen, wie durch den Erinnerungsprozess eine Gegenbewegung zur Sprachlosigkeit in Gang kommt, die als Voraussetzung für die Konstituierung eines weiblichen Ich erscheint. Reicharts Konzept der Erinnerung lässt sich durchaus mit jener von Anna Mitgutsch vergleichen, die diese in ihrer Grazer Poetik-Vorlesung Erinnern und Erfinden als Verschränkung individueller und kollektiver Erinnerung beschreibt.
Als produktiv erweist es sich, mit Bezug zu poststrukturalistischen Subjekttheorien den Roman Das andere Gesicht von Mitgutsch zu lesen, der mit der Konstruktion der beiden Frauenfiguren Jana und Sonja um das Thema des dezentrierten Subjekts und der Ich-Spaltung kreist, das bedeutet, um die Erkenntnis des Fremden in sich selbst. Sonja verkörpert den patriarchalischen Diskurs, während Jana mit ihrer poetischen Sprache subversiv die Dichotomien in Bewegung bringt. Da sprachliche Äußerungen nur im Rahmen der symbolischen Ordnung möglich sind, muss sich die Frau „als Grenzgängerin zwischen dem Schweigen und Sprechen“ (S. 139) positionieren.
Die wichtige Mutter-Tochter-Beziehung steht im Zentrum der Analyse der Romane Die Klavierspielerin und Die Züchtigung. Die besondere Schwierigkeit für die Identitätsfindung des Mädchens besteht nach Irigaray in der Ambivalenz von Identifikation und Distanzierung von der Mutter. In den beiden Romanen nehmen die Mutterfiguren die Rolle des symbolischen Vaters ein, die ihre eigenen unerfüllten Wünsche in die Töchter projizieren und die Subjektfindung der Töchter auslöschen. Durch den Erinnerungs- und Schreibprozess wird im Roman Die Züchtigung die Überwindung des patriarchalischen Diskurses eingeleitet, während in Die Klavierspielerin die Negation des eigenen Körpers „zur irreparablen Schädigung und Auslöschung des weiblichen Ich“ (S. 214) führt.
Renata Cornejo zeigt schlüssig, dass es sich lohnt, mit den Thesen der französischen Theoretikerinnen die untersuchten Romane zu interpretieren, wobei sie betont, dass der psychoanalytische Ansatz bei Elfriede Jelinek, Anna Mitgutsch und Elisabeth Reichart „eng und untrennbar an den sozial bedingten Aspekt (gender) gekoppelt“ bleibt. (S. 215). Bewusst bezieht sich Cornejo sowohl theoretisch als auch in der Auswahl der literarischen Beispiele auf den Zeitraum der 1980er Jahre – je nach Perspektive Vor- und Nachteil der Arbeit. Eines aber ist sicher, auch in den theoretischen Debatten und literarischen Texten von heute bleibt das Dilemma des weiblichen Ich bestehen.