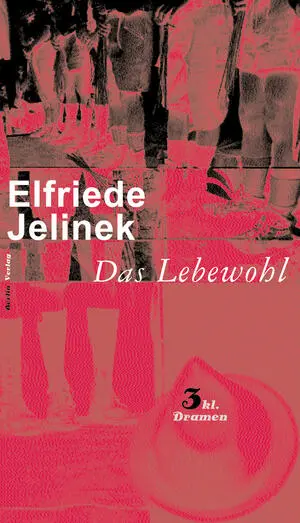Natürlich kommt es anders. Das Lebewohl erzählt von keinem wirklichen Abschied. Im Kreise seiner Getreuen, den wunderschön lächelnden Knaben, atmet der Verführer aus jeder Zeile seine Sehnsucht nach absoluter Macht. Er will zurück, will „alle“, er will geliebt werden von „allen“, und wenn sich „alle“ wehren, dann auch gehasst werden von „allen“, denn: „Wir sind ja alle, weil wir stets gemeinsam wir sind! Die anderen: nur viele! Nur mehr viele! Nicht mehr als viele!“
Ausnahmsweise führt nicht Jörg Haider Regie, sondern eine Frau, Elfriede Jelinek. Ausnahmsweise polarisiert nicht Jörg Haider, sondern eine Frau – ihn. Der Theatermonolog „Das Lebewohl“ zeigt deutlich, warum Elfriede Jelinek den Freiheitlichen ein Dorn im Auge ist. Ihr literarisches Ethos ist unbestechlich, sie lässt sich nicht auf plumpe Demagogie ein. „Das Lebewohl“ besticht als Psychogramm eines Verführers. Der Monolog ist keine gehässige Abrechnung mit Jörg Haider, keine simple Retourkutsche auf verleumderische Angriffe. Der Text ist subversiver, er spürt dem Wesen der Verführung nach, versucht sich an den magischen Beschwörungsformeln der Rattenfänger aller Zeiten. Haider ist Jelineks „Sprachmaterial“, und wenn die Autorin ihr tiefes politisches Unbehagen mit ästhetischen Mitteln formuliert, trifft sie ins Herz.
„Die Schuld, sie schäumt, die alte Gischt. Wir jedoch können schwimmen, tauchen gar!“
Der Berlin Verlag stellt dem Monolog zwei weitere Bühnentexte Jelineks an die Seite – wohl nicht nur aus inhaltlicher Notwendigkeit, sondern auch aus produktionstechnischen Gründen. 35 Seiten „Haider“-Monolog geben, welch letzte Schmach für ihn, noch kein Buch.
Der zweite Text, ebenfalls ein Theatermonolog, heißt „Das Schweigen“. Auch hier will ein Mensch verführen, wenn auch mit lauteren Mitteln. Ein Ich – ein Autor, vielleicht eine Autorin – hadert mit dem Wort. „Das Schweigen“ ist ein manchmal übermütiger, manchmal ein wenig geschwätziger Text über das Schreiben: eine Schrift über Robert Schumann, nein, DIE Schrift über Robert Schumann gilt es zu verfassen. Und frei nach: „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide“ formuliert Elfriede Jelineks Held/in etwas kürzer und postmoderner: „Ich lebe nicht. Ich schöpfe.“. Der dritte und letzte Theatertext „Der Tod und das Mädchen II“ ist Teil eines geplanten „Prinzessinnen-Zyklus“ (Teil 1: „Eine kleine Trilogie des Todes“ erschien 1999). Mit dem „Tod“ kehrt Jelinek nach Österreich zurück. Das Land schläft, Dornröschen gleich, den Schlaf des Vergessens und wartet auf seinen Prinzen. Den guten Prinzen, den bösen?
Der Dialog zwischen Prinz und Prinzessin ist jedoch nicht nur eine politische Parabel, sondern auch eine herrliche, eine naiv-abgründige Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau:
Der Prinz küsst seine Prinzessin wach, aber, seltsamerweise, der Retter ist dem bewährten aus den Grimmschen Märchen keine Spur ähnlich. Die Dornröschen-Prinzessin ist verwirrt. Erst eine wilde Rammelei in Plüschtier- und Häschenkostüm entscheidet die Sache. Die beiden haben einander nun redlich verdient, … im Guten oder im Bösen.