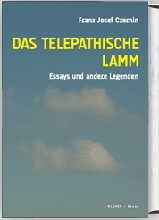Das seltsame Umsprungbild umreißt bei näherem Hinsehen perfekt den Bereich, dem sich die Czernin’schen Essays widmen: Auch der essayistisch arbeitende Dichter bleibt Dichter und die Behandlung seiner Sujets ist selbstverständlich von seiner eigenen Poetik grundiert. So kreisen seine Fragen um die figürliche Rede, um die Übertragung als Prozess im Poetischen schlechthin. Es geht um die Übertragungsvorgänge, die zwischen Ding, Begriff und Ausdruck im Gange sind, wenn Poesie gemacht oder gelesen wird, um das poetisch erzeugte Ding, das als „Übertragung anderer Dingverhältnisse“ begriffen werden kann, um den telepathischen Vorgang des Lesens, der – wie zum Beispiel bei der Lektüre der Texte Mechthild von Magdeburgs – die Sprache so durchsichtig auf ihre Gegenstände werden lässt, dass jene – das Lamm – direkt in den Lesenden übertragen scheinen. Oder die Dinge der Natur werden im metaphorisch-katachretischen Prozess tatsächlich übertragen – in uns selbst, die wir das Gedicht lesen, das einen Nicht-Ort aufsucht, an dem „Natur und poetische Rede auseinander entspringen“.
Die Essays kreisen aber dann auch um den, der überträgt und das Rauschen, das von ihm – unabsichtlich oder nicht – in seinen Botschaften erzeugt wird. Mit großer Gelehrtheit und unbestechlicher Logik geht Czernin den selbst erzeugten „Rauschphänomenen“ – zum Beispiel der Berücktheit durch Texte von Borchardt – auf den Grund. Und ebenso schonungslos analysiert er zum Beispiel Josef Haslingers Roman „Das Vaterspiel“, eine Rezension von Karl Markus Gauß und die populistischen Praktiken in Österreich I oder aber Widersprüche in den poetologischen Schriften Heißenbüttels. Der Dichter als extrem genauer, extrem informierter Leser – das ist vielleicht die erste Position, die Czernin als Essayist einnimmt, dem der Essay dann vor allem einen „Spielraum für definitorischen Möglichkeitssinn“ darstellt – einen Raum, in dem ein „prä- oder postfachlicher Sprachgebrauch“ als „unhintergehbar“ akzeptiert wird, ein Raum auch „integraler Reflexion, die den Grund oder Anfang und das Ende aller theoretischen bzw. wissenschaftlichen Spezialisierung darstellt“.
In diesem Sinn widmet er sich einigen Werken von ihm geschätzter Künstler wie Altenburgs Keramiken, einer Fotografie von Ziviç, Texten von Günter Brus oder den Gedichten Hansjörg Zauners; letztere desavouieren die Anmaßung, sie könnten Spiegel der Realität sein, indem darin Welt auf nicht mehr auflösbare Weise „verkehrt“ erscheint. Gerade um solche poetische Transsubstantiation ist es dem Dichter zu tun. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass er den Ernst, mit dem er sich den Fragen der Poesie, der Sprache, der Kunst widmet, bei seinen Kollegen und Kolleginnen vermisst und essayistische Fehdehandschuhe, wenn nicht wirft, so doch zuweilen sehr höflich überreicht.
Dichtung ist Czernin eine Erkenntnisform, gleichberechtigt neben der wissenschaftlichen oder der philosophischen, wie er in seinem Essay „Dialog mit Giordano Bruno“ anhand eines fingierten Streitgesprächs zwischen den dramatis personae Raoul Schrott, Franz Josef Czernin, Giordano Bruno und einem namenlosen Philosophen expliziert. Für die Lesenden halten diese Essays – wenn auch die Kompetenz des Autors und seine Streitbarkeit zuweilen einschüchternd wirken mag – eine Menge an Erkenntnissen bereit. Es geht hier um die Übertragung des Lamms. Anhand dieser Essays dürfte man lesen lernen.