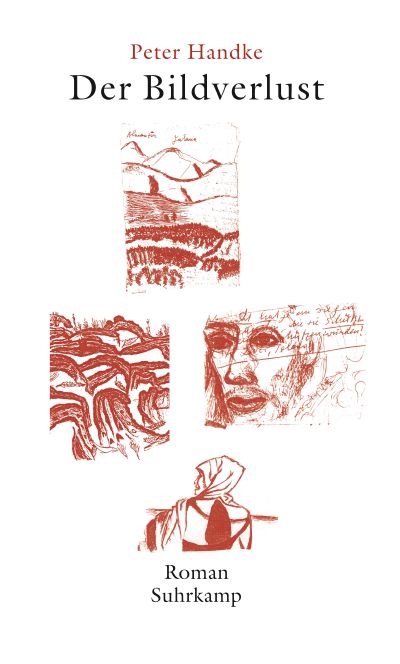Eines Tages verläßt sie ihren Arbeitsplatz in einer nördlich gelegenen europäischen Finanzmetropole, hinter der wahrscheinlich etwas ähnlich Furchtbares wie Frankfurt steckt. Zu Fuß geht es zum Flughafen, durch Randgebiete, die an jene „Niemandsbucht“ erinnern, in der sich Handke mit seinem vorletzten Roman aufhielt. Es ist dies eine Zwischenwelt, für die sich ansonsten kaum jemand interessiert, geschweige denn, daß jemand auf die Idee käme, durch dieses Nichts auch noch hindurchzuwandern. Die Geldexpertin aber passiert den Stadtrand und durchmißt dabei eine Strecke, in der alles eine Vorfreude ist: Die „nun bald-“ und „noch nicht ganz“-Wendungen häufen sich.
Schließlich landet die Frau im spanischen Valladolid und macht sich von dort zu einem Fußmarsch auf, der sie über die titelgebende Sierra de Gredos hinweg in jenes Dorf führt, in dem der Autor der Geschichte lebt. Wie es sich für einen durchorganisierten Menschen gehört, hat sie mit dem Schreiber einen Vertrag geschlossen, der alle Details regelt. Er soll ihre Wanderung unter konsequenter Vermeidung von Reiseführerprosa nach Art einer Expedition erzählen. Als Voraussetzung dafür müsse sowohl mit journalistischem „Storyeifer“ (den Handke wie die Pest haßt) als auch mit „Realitätsgeprotze“ (siehe oben) Schluß sein. Statt dessen ist die Geschichte der Frau wie ein „inwendiges“ Abenteuer zu erzählen und jedenfalls so, daß bei ihr ein andauerndes Gefühl des „mich erzähltwerden spüren“ aufkommt.
Vom „was“ des Erzählens ist der Akzent solcherart rasch auf sein „wie“ gelenkt. An manchen Stellen schweift der fingierte Autor dann entgegen seinem Auftrag doch auch zur Vorgeschichte der Frau ab. Er berichtet von einem Bruder, der lange im Gefängnis saß, und von einer verlorenen Tochter, der sie in stillen Momenten nachweint. Auch die Herkunft der Familie klärt sich. Sie stammt aus einem sorbischen Dorf in Ostdeutschland, gehört aber innerhalb dieser slawischen Minderheit einer noch kleineren Gruppe an, nämlich der Nachkommenschaft eines arabischen Kaufmannes, den es vor Urzeiten in den Norden verschlagen hat und der wohl auch die besondere Affinität der Geldexpertin zu Spanien erklärt. Unzweifelhaft ist es eine Ursprungsgeschichte, die Handke erzählt. Der Gegenwart wird etwas Längstvergangenes entlockt, allein für sich wäre die Jetztzeit trostlos. Es gibt in ihr (und diese Klage ist bei Handke zur Freude aller Kulturpessimisten mehr oder weniger wortwörtlich nachzulesen) keine Liebe und kein Vertrauen und vor allem keine gute Nachbarschaft. Der Zustand der Welt ist so, wie er es in den letzten Büchern des Autors war: ein permanenter Vorkrieg, in dem der Krieg erst gar nicht mehr erklärt zu werden braucht.
Je schlimmer der Zustand der Welt, desto größer die Herausforderung an das Erzählen. Bei Handke sieht diese andere, poetische Welt zunächst recht idiotisch aus. Die Geldexpertin, die dem Mammon abgeschworen hat, durchwandert immer seltsamer werdende Orte und trifft dabei auf immer seltsamer werdende Menschen. Die Dramaturgie folgt, ohne in dieser Weise spektakulär und mit dem dortigen Schreckensende behaftet zu sein, dem Muster von „Apocalypse Now“. Das „Herz der Finsternis“ ist bei Handke dann doch zum Herzerwärmen: Die Heldin findet in einer Gebirgssenke ganz oben in der Sierra den allerseltsamsten, für sie aber heilsamen Stamm. Um die Leute zu beschreiben, hat der fingierte Autor seinerseits einen Hilfsschreiber engagiert. Dessen ethnographischer Bericht steht dem ursprünglich erteilten Schreibauftrag entgegen und bietet von den sogenannten Hondarederos zunächst ein jämmerliches Bild.
Die Leute, allesamt Überlebende eines nicht näher bezeichneten Unheils, haben der Zivilisation auf eine wirklich dummdreiste Weise abgeschworen. Objektive Längen- und Zeitmaße sind ihnen unbekannt, statt dessen teilen sie die Welt in Wurf- und Körperdistanzen sowie in eine lose Abfolge von Tagen. Ein „Eintagesvolk“, heißt es in dem Bericht, seien diese Muldenbewohner, eine „Robinsonrotte“, deren ausgeprägter Sinn für Häßlichkeit sich in jedem Detail bis hinab zu den Socken zeigt, von denen sie stets zwei verschiedene trügen. Kindisch seien die Umwege, die sie bei jeder Gelegenheit gingen. Selbst wenn sie sich nur über eine kurze Distanz hinweg einen Gegenstand zuwürfen, hätte dies in einem unnötig großen Bogen zu geschehen. Ganz so, als wollten sie ständig etwas von dem in die Luft zeichnen, was sie nicht mehr in sich trügen: nämlich jene unaufhaltsame Serie von Bildern, von der die moderne Welt überquillt.
Die Geldexpertin, die von der langen Reise Richtung Mancha (denn so wird das Zielgebiet tatsächlich genannt) offenkundig für eine neue Art des Denkens disponiert ist, sieht die Dinge naturgemäß anders. Im beschriebenen Bildverlust erkennt sie die Chance, die Metaphern vom Wesen der Welt noch einmal in ihrer vollen Erkenntniskraft entfaltet zu sehen. Die Frau landet schließlich in einer mit Farn ausgekleideten Grube und erleidet dort ihr finales Glücksgefühl. Die europäische Literatur kennt ein Buch, das just den umgekehrten Prozeß, nämlich die epochale Außerkraftsetzung der Bild- und Ähnlichkeitsbeziehungen beschreibt. Es ist Miguel de Cervantes „Don Quijote“, ein Werk, das eben nicht das Ende des Rittertums, sondern die Außerkraftsetzung imaginativer Erkenntnis zum Inhalt hat. Der Ritter von der traurigen Gestalt hält bis zum Schluß an seinen Analogien fest, die jetzt aber nicht mehr zur Erklärung der Welt, sondern bestenfalls noch für die Literatur taugen.
Wie eine lockere Schraube dreht Handke seine Heldin aus der Gegenwart heraus und in eine Gedankenwelt hinein, die zwar von gestern stammt, mit der es in Zukunft aber doch noch eine Bewandtnis haben soll. Mit seinem Buch legt der Autor einen neuen Don Quijote vor und er tut dies mit vollem Vorsatz. Gleich als Motto findet sich das Cervantes-Zitat: „Aber vielleicht haben die Ritterschaft und die Verzauberungen heutzutage andere Wege zu nehmen als bei den Alten“. Und gegen Ende heißt es sinngemäß, daß die unternommene Beschreibung des Bildverlustes nicht nur unserer Zeit, sondern auch noch den kommenden Jahrhunderten genügen muß.
Wo die Hybris so groß ist, macht sie schon fast wieder Spaß. Weitgestreckte Ziele sind in der Literatur allemal spannender als jene Selbstbescheidungen, von denen es derzeit nun wirklich genügend gibt. Wenn man gegen Windmühlen kämpft, tut man es am besten gleich ordentlich. Peter Handke macht vor, wie es geht und welche Meisterschaft man in diesem selten geübten Sport auch heute noch erringen kann.