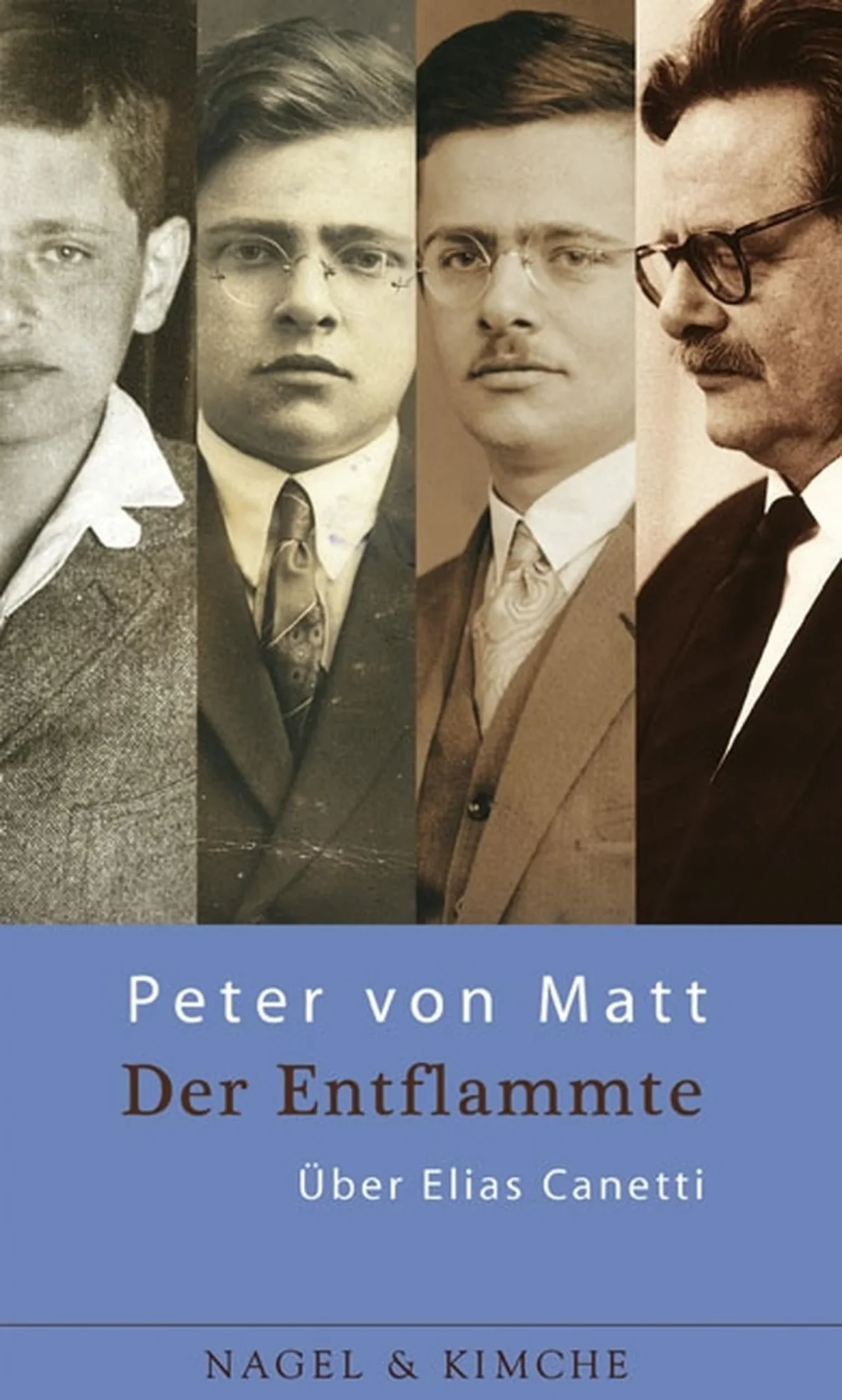Umso erfreulicher, dass nun ein schmales Bändchen des Schweizer Literaturwissenschaftlers Peter von Matt erschienen ist, das mächtig Lust weckt, Elias Canetti (wieder) zu lesen. Von Matt war einer der ganz wenigen Germanisten, die Canetti akzeptierte trotz all seiner Skepsis, ja seinem Widerwillen und Zorn systematischer Wissenschaft gegenüber. Ihm blieb auch erspart, verstoßen zu werden, wie Claudio Magris, der zu jenen (von Sven Hanuschek in seiner großen Biographie Angeführten) gehörte, denen Canetti freundschaftlich verbunden war und die er plötzlich aus eher nichtigem Anlass kalt zurückwies.
Dass Canetti mit seiner Erwägung, Peter von Matt die wissenschaftliche Betreuung seines Nachlasses zu überantworten, richtig lag, bestätigt das Dutzend zu verschiedenen Anlässen entstandener, gattungsmäßig den Bogen von der Rezension über Würdigungen, Nekrologe bis zur persönlichen Erinnerung spannender Beiträge im vorliegenden Buch. Sie sind allesamt, beginnend mit der Besprechung von Canettis Kafka-Essays Der andere Prozeß aus dem Jahr 1969 bis hin zu Peter von Matts Rede anlässlich der Eröffnung der 2005 zuerst in Zürich, dann auch in Graz, Wien und München gezeigten großen Jubiläums-Ausstellung Das Jahrhundert an der Gurgel packen – Elias Canetti 1905-1994 geprägt von wissenschaftlicher Seriosität trotz unverhohlener Faszination sowie von Sensibilität und untrüglichem Gespür für wesentliche Aspekte von Canettis Werk. Selbst im Bericht von persönlichen Begegnungen bleibt der Verfasser ganz uneitel, bringt den Autor nahe, indem er schildert, welche Bilder von ihm in seiner Erinnerung haften geblieben sind, enthusiasmiert vor allem den „Furor“ des mündlichen Erzählers Canetti, der es verstanden hat, seinen „Begriff vom Wort als einem körperhaft tönenden Wesen“ zu verlebendigen.
Mit der Betonung des Körperlichen ist ein wichtiges Stichwort gefallen und einer der ganz wichtigen Aspekte von Canettis Schaffen angesprochen, der sich wie ein roter Faden durch die auf den ersten Blick sehr disparat erscheinenden Beiträge zieht. Neben der Körperlichkeit sind es das schon angesprochene antisystematische Denken, der zentrale Begriff „Verwandlung“ und die Vorliebe für den Aphorismus. Die einzelnen Arbeiten Peter von Matts nun kreisen jeweils um einen oder mehrere dieser Aspekte, die zudem untereinander in einem engen Konnex stehen.
Peter von Matt hat bereits in der Besprechung des Kafka-Essays Canettis „besonderes Sensorium für alles Somatische“ beobachtet und damit ins Zentrum von dessen Denken geführt. Auch wenn das Wissen über die Beschäftigung des jüngeren mit dem verehrten älteren Autor durch Kenntnis der „Kafka-Schachtel“ (Irmgard Wirtz) im Nachlass in der Zentralbibliothek Zürich mittlerweile größer geworden ist, hat der Rezensent von 1969 gleichwohl schon Wesentliches erkannt, nämlich dass Canettis Studie die Strukturierung des für Lesende nachgerade „beängstigende[n] Konvolut[s]“ der Briefe Kafkas an Felice Bauer leistet. Canetti liest sie als „Abbild eines dramatischen Prozesses“, in dem die zeitweilige Verlobte des Schriftstellers diesem als „Nahrung“ für dessen literarisches Schaffen dient, zeigt sich von der Verwandlung ins Kleine begeistert, mit der sich Kafka „der Macht in jeder Form zu entziehen“ vermochte, und erkennt, dass dieser sein Schreiben als Lebensprinzip absolut gesetzt hat, unvergleichlich zum Ausdruck gebracht in jenem Canetti zutiefst berührenden und mittlerweile, wie Peter von Matt zurecht prophezeit hat, berühmt gewordenen und viel zitierten Wunsch Kafkas, sich vor allen Anfechtungen des Lebens zum Schreiben in den hintersten Winkel eines Kellers zurückziehen zu können. Die Lesart Canettis überzeugt von Matt weitgehend. Keineswegs verharrt er aber in diesem wie in den späteren Beiträgen in unkritischer Verehrungshaltung, stößt sich vielmehr vor allem an der allzu glatten Analogsetzung von Biographischem („Mühen um Felice“) und Fiktion (bezogen auf den Prozeß), moniert zudem, dass der Essayist die Machtausübung des Briefschreibers Kafka über Felice zu wenig beachte.
Felice dient Kafka als Nahrung, dieser gewissermaßen dem Leser Canetti in einem Akt der Anverwandlung ebenfalls: „Seht her, der hat mich ernährt“, so eine von dessen charakteristischen Äußerungen über sein Verständnis der „Erkenntnis der Welt durch Einverleibung“ allgemein, von Literatur im speziellen. „Verwandlung“, bekanntlich ein zentraler, allerdings kaum zu fassender Begriff Canettis, kann auch als Voraussetzung der Abgrenzung vom anderen verstanden werden, insofern sie „mit dem wichtigsten und vielleicht schwierigsten Geschehen in Canettis Lesen und Schreiben“ zu tun hat, mit „dem Moment, wo die Verwandlung in das Gegenüber zur scharfen Trennung wird. Das Ich wird zum Andern in einem Akt nie ganz erklärter Verschmelzung, diese aber ist die Voraussetzung dafür, daß der Andere im Akt der Trennung der wirklich Andere des Ichs sein und bleiben kann. Nur die Verwandlung macht die Abgrenzung möglich, in der der Andere in sein Recht und seine Würde tritt.“ Peter von Matt ist klar, dass dies mysteriös klingt und die Gefahr der Beliebigkeit in sich birgt, gleichwohl verweist er auf die „Fruchtbarkeit“ von Canettis Verfahrensweise im Umgang mit Dichtern.
Diese Methode hat zu tun mit dem besonders auch dem jeglicher Kategorisierung widerstrebenden Opus Magnum Masse und Macht eingeschriebenen Widerwillen gegen Denken in Systemen, das dem Totalitätsanspruch von Vernunft folgt und alles auf den Begriff zu bringen vermag. Insofern ist Canetti durchaus aktuell: Insbesondere den Strukturalismus hielt der Autor aufgrund seines analytischen, daher Mythen zerstörenden Verfahrens für barbarisch. Dagegen setzt er sein (im Selbstverständnis) Mythen rettendes Erzählen, womit er Peter von Matt durchaus aktuell erscheint: „Als der Strukturalismus in die Postmoderne kippte, sah man verblüfft, daß Canetti da schon längst angekommen war“, was sich im übrigen nicht nur an Masse und Macht, sondern besonders schön am Kafka-Essay zeigen ließe, der in seinem Erscheinungsjahr 1969 tatsächlich anachronistisch erscheinen musste. Und es erweist sich immer wieder an den Aufzeichnungen, von Hanuschek nicht zu Unrecht als „Canettis Gebirgsmassiv“ bezeichnet.
Canettis Neigung zum Aphoristischen, die Peter von Matt ebenfalls frühzeitig erkannt und immer wieder mit Nachdruck vermerkt hat, steht in engem Zusammenhang mit seinem Denken wider Systemzwänge. In dieser Gattung werden nicht Wahrheiten festgeschrieben, sondern momenthaft zum Aufblitzen gebracht und dem jeweils eigenen Denkprozess der Lesenden überantwortet. Diese werden durch „ein semantisches Oszillieren“ abrupt „in eine seltsame hermeneutische Turbulenz“ versetzt und zur Zwiesprache gezwungen (Stefan Kaszynski hat in diesem Sinne nachdrücklich und zurecht auf den „dialogischen Charakter“ der Canettischen Aphorismen aufmerksam gemacht). Hierin setzt er die Tradition eines Lichtenberg fort, auch eines Hebbel, wo diesem – gegen sein Zielen auf „Wahrheit“ als „System“ – wider Willen „unkontrollierte, plötzliche Wahrheiten“ unterlaufen.
Peter von Matts diverse Beiträge sind voll von weiteren interessanten Detaileinsichten in das Werk Canettis und sie bereiten Vergnügen. Was er an Canetti und dessen Nähe zum „Schriftsteller Freud“ (nicht zum Systematiker) bewundert, nämlich, dass sie „können, was bei uns rar ist, schwierige Dinge in einer ganz lauteren Sprache sagen“, das gilt auch für ihn selbst – eine seltene Tugend bei Literaturwissenschaftlern.