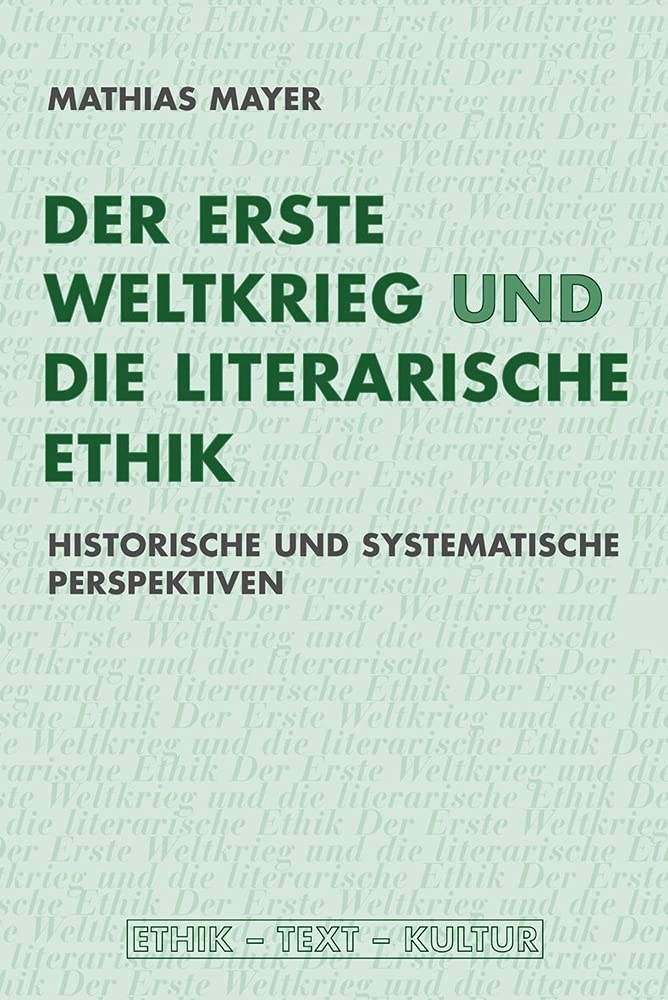Mathias Mayer geht über diesen Befund hinaus und zeigt an einer Reihe von Beispielen, dass die Zeit der fragwürdig gewordenen Moralbegriffe zugleich eine Epoche der ethischen Dauerreflexion gewesen ist. Schwindende Moral – aufkeimende Ethik: Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, erweist sich in Mayers Darstellung als komplementär. Denn das Hauptanliegen dieser Ethik bestand nicht darin, neue Morallehren zu etablieren; ihr ging es vielmehr darum, die Bedingungen zu untersuchen, unter denen moralisches Handeln und Denken möglich oder eben unmöglich ist. Für diese Reflexion auf der Meta-Ebene ist nach Mayer die Ethik zuständig, während die Aufgabe der Moral darin besteht, lebbare Verhaltenslehren zu formulieren. Da dies in Zeiten der Krise aber nicht ganz einfach ist, steigt der Bedarf nach umfassenden ethischen Vergewisserungen.
Hier schließt sich nun eine zweite Erkenntnis Mayers an: Das intensivste Nachdenken über Grundsatzfragen des Lebens hat in der ersten Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts kaum in der Form einer systematischen Philosophie oder –theologie stattgefunden, denn auch die lehrhafte Systematik war der Fragwürdigkeit anheim gefallen. Stattdessen erschienen literarische Ausdrucksweisen als die angemessene Form für eine zeitgemäße Ethik. Das aber bedeutet zum einen, dass die Literatur ethischen Impulsen gehorcht, zum anderen aber auch, dass aus der „philosophischen“ Ethik eine „literarische“ wird. Dieses Ethischwerden der Literatur (bzw. dieses Literarischwerden der Ethik) untersucht Mayer in seiner philosophisch und literaturwissenschaftlich anspruchsvollen Studie. Philosophisch ist dabei die Erkenntnis, dass eine solche „literarische Ethik“ eine wichtige Funktion im damaligen Denken übernommen hatte, literaturwissenschaftlich ist die Frage, in welchen Formen und Ausdrucksweisen sie sich artikulierte.
Zur Klärung dieser Frage untersucht Mayer die „Strategien literarischer Ethik“ (wie er sie ganz unpazifistisch nennt), wobei er im Besonderen die satirische Entlarvung kriegerischer Scheinmoral (Karl Kraus), die Konstruktion des großen utopischen Gegenentwurfs (Ernst Bloch) und schließlich das alle Gewissheiten erschütternde Spiel mit dem Paradoxon (Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal) in den Blick nimmt. In einem zweiten, noch enger literaturwissenschaftlich gefassten Teil, geht Mayer dann auf eine Reihe repräsentativer Werke der Epoche ein, in denen die genannten „Strategien“ in unterschiedlichen Mischungen auftreten: Thomas Manns „Zauberberg“, Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“, Hermann Brochs „Die Schlafwandler“ und Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“. In umfassenden Interpretationen erschließt Mayer diese kanonischen Texte der Zwischenkriegszeit, aber so kenntnisreich und eindringlich seine Analysen sind, so geradlinig bleibt doch sein Grundanliegen: Er möchte immer wieder neu aufzeigen, dass der Motor all dieser Werke ein ethisch motiviertes Nachdenken über die Conditio humana nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war.
Wie das Beispiel Bloch schon zeigte, behauptet Mayer nicht, das Nachdenken über Ethik sei gänzlich in den Zuständigkeitsbereich der Literaten übergegangen. Ganz im Gegenteil: Er beschäftigt sich eingehend mit Philosophen wie Ernst Bloch, Georg Lukács und anderen. Doch zeigt er zugleich, dass auch der Essayismus dieser damals jungen Denker von genuin literarischen Schreibweisen Gebrauch machte. Als wichtigstes philosophisches Vorbild dafür macht Mayer den Theologen, Philosophen und Literaten Sören Kierkegaard namhaft, während er Fjodor Dostojewski als bedeutendsten literarischen Anreger für alle Autoren dieser Zeit hält. Diese beiden Geister des 19. Jahrhunderts gelten ihm als die wichtigsten Ahnherren jener literarischen Ethik, die dem Wertezerfall entgegenarbeitet. Ein anderer Vordenker, dessen Wirkungsmacht jeder Literaturgeschichte geläufig ist, wird von Mayer stark relativiert: Immer wieder werde behauptet, Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ sei in den Schützengräben als militaristische Erbauungsliteratur im Gebrauch gewesen, doch entspräche das, so Mayer, der Wahrheit nur sehr eingeschränkt. Mit einem spöttischen Ausdruck Alfred Döblins vermerkt Meyer, dass während der Gräuel des Krieges eine „Nietzschedämmerung“ heraufgezogen sei. Nietzsches selbstherrlicher Amoralismus habe unter dem Eindruck von Leid, Krieg und Sinnkrise seine Anziehungskraft verloren und die theologisch inspirierten Denker Kierkegaard und Dostojewski hätten Bedeutung gewonnen. (Der Gedanke, dass martialisch riskante Denkgebärden vor allem in friedlichen Zeiten reizvoll sind, verdiente durchaus auch im Hinblick auf unsere Gegenwart eine genauere Vertiefung.)
Mayer respektiert Nietzsche durchaus als bedeutsamen Repräsentanten des Wertezerfalls, aber sein Hauptinteresse gilt nicht ihm, sondern den Gegenkräften. Alle Denker und Dichter, die für das Kämpferische anfällig waren, werden von Mayer kritisiert – dies nicht aus literaturkritischen, sondern aus ethischen Gründen. Die Kampfmoral eines Soldaten wie Ernst Jünger, der den Krieg „als inneres Erlebnis“ akzeptiert, wenn nicht sogar feiert, ist für Mayer keine ethisch vertretbare Haltung. Das wird an vielen Stellen seines Textes deutlich, und darin liegt auch die pazifistische Botschaft, die der Autor seinen Lesern mitteilen will. Für diesen Literaturwissenschaftler ist die Ethik kein Forschungsgegenstand unter vielen; Ziel seiner Arbeit ist es, Beiträge zu einem ethisch verantwortlichen Denken zu liefern, das auch heutigen Herausforderungen gewachsen wäre. Vehement widerspricht Mathias Mayer im Schlusskapitel seiner Studie der häufig zu hörenden Meinung, die geistigen Bemühungen der Zwischenkriegszeit seien umsonst gewesen, weil es ihnen nicht gelungen sei, den Nationalsozialismus und die Shoa zu verhindern. Dem setzt Mayer die Überzeugung entgegen, dass das „Potential der Freiheit“ gegen alle Gewalt gesichert werden könne, indem man sich erzählend an frühere Freiheitsmomente erinnert: „Nicht der vorschnell verkündete Untergang eines ethischen Bemühens in den Folgen von 1933 ist somit ein Ausweg aus der Gewaltsamkeit, sondern die Insistenz auf dessen Notwendigkeit, und sei sie auch der jeweiligen Unfreiheit unterlegen, bleibt unverzichtbar“. Mit diesem teils nachdenklichen, teils kämpferischen Satz endet Mayers Studie, die ausdrücklich an jene „literarische Ethik“ anknüpft, die sie mit den Mitteln der Geisteswissenschaft untersucht.