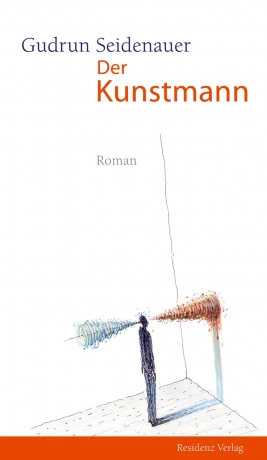Josef Eisner gehört der zweitgenannten Spezies an. Als angesehener Literaturwissenschaftler und Professor an der Universität hat er es im Lauf seines Lebens zu etwas gebracht: seine Studenten beten ihn an, wenn er über Rilke oder Kafka referiert und bei all seiner Distanziertheit anderen Menschen gegenüber wird er doch von vielen geliebt, weil er andere zu Wort kommen lässt, auch wenn diese weniger qualifiziert sind als er selbst: Josef Eisner ist ein Professor der alten Schule, dem man Respekt und Bewunderung entgegenbringt – über den man allerdings nicht viel weiß. Selbst seine engsten Vertrauten und Mitarbeiter kennen ihn kaum. Das muss auch Roland Klement feststellen, der Assistent Eisners, dessen Lebensweg schon eine ganze Weile parallel neben dem von Eisner verläuft. Man geht in der Universität gemeinsam Kaffee trinken, diskutiert über Fachliches, besucht einander – ohne jedoch allzu persönlich zu werden. Der Assistent genießt diese Vertrautheit, diese Art Freundschaft, weil er von ihr profitiert, aber auch weil er in seinem Professor ein Vorbild, eine Art Lebenssinn gefunden hat.
Umso erstaunter ist Klement, als er in der Zeitung von der angeblichen Nazi-Vergangenheit seines geliebten Meisters liest: „Renommierter Germanist als hochrangiger SS-Mann enttarnt.“ In dem Artikel ist von Eisners angeblicher Vergangenheit als Mitglied der SS-Organisation „Ahnenerbe“ die Rede, von verfassten Schriften über die Wurzeln „germanisch-arischer Kulturkreise“, von propangandistischem Engagement, von Manipulation und Missbrauch der deutschen Sprache usw. Unter dem Artikel befinden sich eine Fotoaufnahme und der damalige Name Eisners: Josef Engler. Ungläubigkeit, das ist das erste, womit Klement reagiert: „Eisner war Eisner und nicht irgendein junger glattgesichtiger Kerl in SS-Uniform.“
Nach dem öffentlichen Geständnis Eisners, dessen spätes Outing einer Erpressung geschuldet ist, gibt es allerdings keinen Zweifel mehr: Der SS-Mann Engler und der Literaturprofessor Eisner sind ein und dieselbe Person, auch wenn zwischen ihnen bereits mehr als fünfzig Jahre liegen. Klements Welt gerät durch diese Erkenntnis vollends aus ihren Bahnen. Fortan recherchiert er wie bessesen alles, was er zum „Fall Eisner“ finden kann. Er verkriecht sich in seiner Arbeit und lässt in seinem Selbstmitleid nichts an sich heran: Er fühlt sich betrogen – um sein bisheriges Leben, um seine Wertvorstellungen; alles, an das er bisher glaubte, ist für ihn verloren. In seinem Selbstmitleid und seiner Verachtung gegen Eisner denkt er gar nicht an die Möglichkeit einer Konfrontation mit dem Professor. Er zieht sich stattdessen zu einem Familienurlaub mit seinen Sohn zurück, nachdem seine Depressionen infolge des Geschehenen die Beziehung zu der lebenslustigen Lina zerstört haben.
Erst als er sich mit dem Kollegen Hirsch trifft und dieser ihn davon überzeugt, doch erst einmal mit Eisner zu sprechen, zieht er eine Begegnung mit dem Professor in Betracht. „Zuhören, ihn zum Sprechen ermutigen, mich aber nicht von seiner Version der Geschichte gefangen nehmen lassen“ ist das Ziel Klements. In einem für beide Seiten aufwühlenden Treffen gelingt es dem Assistenten schließlich auch, Eisner zum sprechen zu bringen, sofern dies noch möglich ist. Denn Eisner hat ausreichend Verdrängungsarbeit geleistet, so dass die einzelnen Taten und Geschehnisse erst langsam wieder in ihm aufkommen. Eisner schwankt zwischen eigenem Schuldzugeständnis und dem Verstecken hinter der Sprache – der Sprache, die keine direkten Taten beinhaltete, aber doch Voraussetzung für die geschehenen Verbrechen war. „Was macht es für einen Unterschied, dass ich und nicht ein anderer?“, fragt Eisner immer noch, was Klement umso mehr provoziert. Er verweist auf seine Leistungen nach dem Krieg, dass er verbotene Literatur für sich gerettet habe, dass er sich schließlich verändert habe und nunmehr ein anderer sei; kein Nazi, was Klement am besten wissen müsse. Das Ende des Gespräches ist kein wirkliches Ende. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Erschöpfung vertagt Eisner das Gespräch, nachdem er jedoch unerwartet die Mitwisserschaft in Bezug auf die Massenvernichtungen eingestanden hat – ein Eingeständnis, das Klement vollkommen aus dem Konzept wirft.
Ein weiteres Gespräch, das in der darauffolgenden Woche stattfinden sollte, gibt es nicht mehr. Eisner stirbt an einer Gehirnblutung. Und während ihn die Öffentlichkeit und die Universität auch im Tod noch schneiden, erweist ihm Klement am Grab die letzte Ehre, wenn er sich auch eingestehen muss, Eisner nie richtig verstanden zu haben.
Gudrun Seidenauer, die mit Der Kunstmann ihren ersten Roman vorlegt und davor mit ihrer Lyrik bereits auf sich aufmerksam machte (Salzburger Lyrikpreis), gelingt es treffend, die menschlichen Spannungen und Zwischentöne im Umgang mit der Vergangenheit aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund des intellektuellen Milieus wird die Schuldfrage erneut erörtert und die Sprache – und nicht die Tat – als Instrument in den Raum gestellt. Die SS-Organisation „Ahnenerbe“, die bislang kaum Erwähnung fand, steht hier im Mittelpunkt – eine Organisation, die 1935 von Himmler gegründet wurde und den Versuch unternahm, die politische Macht der SS auch auf den geistigen Bereich auszudehnen. Schließlich kann es auch hier keine Ideallösung im Umgang mit der braunen Vergangenheit geben.
Das Geschehen wird aus der Sicht des jungen Kollegen Klement geschildert, der sich mit Eisner und der älteren Generation auseinandersetzt, so dass die Gegenwart ohne weiteres an die Vergangenheit anknüpfen kann. Zudem zeichnet sich das Thema aufgrund der literarischen und politischen Debatten der letzten Jahre ohnehin durch Aktualität aus. Die Sprache erscheint dem Geschehen angemessen, klar und distanziert – und doch wird mit ihr gespielt, denn sie ist es, die in diesem Roman im Vordergrund steht, die aus Worten mehr als bloße Worte macht(e): ein virtuoses Debüt, von dessen Autorin man sich noch einiges versprechen darf.