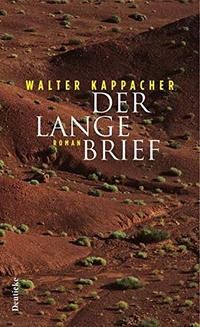Walter Kappacher ist wohl einer von ihnen. Zurückgezogen lebt der 69-Jährige im Salzburger Land. Martin Walser hat seinen 1972 erschienenen Roman „Morgen“ in der „Zeit“ überschwänglich gelobt, den großen Durchbruch hat Kappacher aber nicht geschafft. Zu disparat ist sein Werk, zu schwer ist es auf einen mediengerechten Nenner zu bringen. Romane hat er geschrieben, Erzählungen, an Drehbüchern hat er mitgewirkt. Nie hat seine Literatur auf Erfolg spekuliert, nie hat der Autor nach Anerkennung geschielt. Immerhin wurden Kappacher in den letzten Jahren zwei wichtige Preise zugesprochen, so erhielt er etwa 2004 den Hermann-Lenz-Preis (Peter Handke sprach die Laudatio), letztes Jahr wurde er mit dem Großen Salzburger Kunstpreis ausgezeichnet. Kappachers Literatur aber hätte sich sicherlich mehr verdient. 2005 erschien sein wunderbarer Roman „Selina“, der zu Recht hymnische Kritiken im deutschen Feuilleton erhielt, ein wohltuend zurückhaltendes Buch, an dem alles stimmt, die reife Frucht eines langen Schreiberlebens, ein – man soll das hohe Wort auch ruhig einmal aussprechen – vollkommenes Buch.
Nun hat Deuticke den 1982 erstmals erschienenen Roman Der lange Brief neu aufgelegt. Kappacher beschreibt darin die Geschichte Rofners, eines Angestellten der Salzburger Pensionsversicherungsanstalt, der im Beruf unglücklich ist, sich ein neues, erfüllteres Leben wünscht (ähnlich wie Thomas Bernhard in seinem autobiografischen Band „Der Keller“ sich nach dem Weg „in die entgegengesetzte Richtung“ sehnt). Sein Dasein ist die krampfhafte Suche „nach dem Zipfel eines anderen Lebens, des Versuches, aus dem kleinen Kreis, den ich um mich gezogen hatte, herauszuhüpfen.“ Sein Vorbild findet er im Kollegen S., der seinen Job bei der Pensionsversicherungsanstalt gekündigt hat und seitdem verschwunden ist. Rofner interessiert sich für S., macht sich an dessen frühere Freundin Eva heran, um so an die Aufzeichnungen von S., den „langen Brief“, heranzukommen. Diese Aufzeichnungen, die einen großen Teil des Romans einnehmen, hat S. Eva geschickt.
S.‘ langer Brief hat zwei große Teile. Der erste spielt in Detroit, der amerikanischen Autostadt, in der ein Bürgerkrieg ausbricht, weil die Bewohner in der Hoffnung auf ein neues, befreites Leben die Fabriken verlassen und ihre neuen Autos anzünden: „Destroy what destroys you.“ Die ökologische Revolution artet aber schnell zum Bürgerkrieg aus, die Armee schlägt den Aufstand brutal nieder, der junge Erzähler, der an der Revolte teilgenommen hat, flüchtet mit seiner Freundin Eve aus der Stadt.
Ein Schauplatzwechsel markiert den zweiten Teil des Briefes. „Es war nur folgerichtig, daß wir, als sich die Gelegenheit bot, aufbrachen, um zu vernichten, was uns und die nachkommenden Generationen zerstörte. Die Zeit war reif geworden für eine Neuordnung des menschlichen Zusammenlebens, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung sich daran gewöhnt hatte, daß keiner mehr die Tür öffnete, ohne gleichzeitig den Lauf seines Gewehrs auf die Sicherheitskette zu legen, daß verstört wuchernde Zellen ihr Leben mehr bestimmten als alles andere, daß der einzige Lichtblick in ihrem Dasein die bunten Pillen und der fahl in allen Regenbogenfarben flimmernde Bildschirm an der Wand mit seinen hundert Programmen war.“ Mit seiner Freundin Eve will der Erzähler nach Australien ins Dorf Moville, wo einige Amerikaner und ein australisches Ehepaar eine neue Gemeinschaft aufbauen, „in der die Erkenntnisse von Naturvölkern, insbesondere der Indianer Nordamerikas, und die brauchbaren natur- und menschenfreundlichen Kenntnisse und Einsichten der Gegenwart gleichermaßen angewendet werden sollten.“ Beim Umsteigen auf einem australischen Flughafen aber stürzt der Erzähler die Gangway hinunter, verletzt sich schwer. Er muss Wochen im Spital verbringen und verliert Eve aus den Augen, sie ist fort und kommt nicht wieder. Vom Dorf Moville will niemand gehört haben, den Weg dorthin wird er nicht finden. Pleite und am Ende seiner Kräfte wird er schließlich von der Doctora, einer alten Frau, die allein im Busch lebt und Felszeichnungen der Aborigines erforscht, aufgelesen. Mangels fehlender Perspektiven zieht er bei ihr ein, verrichtet Hausarbeiten für die schon gebrechliche Frau und findet nach und nach in sein „neues“ Leben im Busch. Der Roman endet damit, dass Rofner es S. nachmacht und seine Arbeit kündigt.
Walter Kappacher hat einen Roman geschrieben über Träume vom neuen Leben, von Aufbrüchen ins ungewisse, aber menschengemäßere Leben, von Sehnsüchten, die ihren Preis haben und sich nur über Umwege erfüllen können. Der lange Brief ist aber auch ein Buch über die Macht von Literatur. Was vermögen Geschichten ihren Lesern zu geben? Können sie Leben beeinflussen und verändern? Kappacher beantwortet die Frage mit einem eindeutigen Ja. Und er zeigt, dass der Weg zum Glück nicht von anderen bereitet werden kann, sondern dass er selbst gefunden und gegangen werden muss. Es ist erstaunlich, wie aktuell, wie zeitlos der Roman 25 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung geblieben ist – Kappacher hat sich eben nie den Moden des Betriebs unterworfen.
Peter Handke schrieb in seiner Laudatio für Walter Kappacher zur Zuerkennung des Hermann Lenz-Preises: „Gegenläufig zu vielem, nicht allem, was heute geschrieben wird, tut und schafft er etwas: Er macht nicht die Conférence des Zeitgeistes oder die Conférence der neuesten Dinge oder eher Produkte; er ist kein Alleinunterhalter, wie nicht wenige der heutigen Schreiber, die dem Leser so unernst etwas vorspielen, daß diesem, dem Leser, selber nichts mehr zu spielen übrig bleibt. […] Walter Kappacher dagegen schafft und tut, und, vor allem, vorerzählt (nicht nacherzählt), läßt mich, den Leser, den Anderen, den anderen Menschen sehen. Und er läßt mich den anderen Menschen sehen zusätzlich als den Fremden – etwas, was wir inzwischen wieder beinahe vergessen haben. Und deswegen ist er […] Schriftsteller, ein Seltener.“