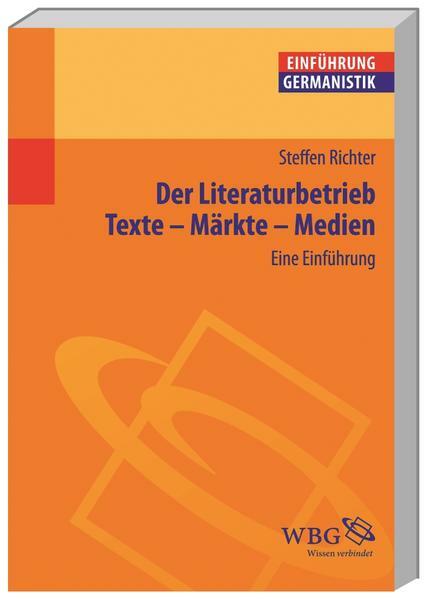Und damit sind nicht nur Themen gemeint, die in anderen Einführungen manchmal unterbelichtet bleiben: So bietet beispielsweise die Berücksichtigung der „einschneidenden Veränderungen des Literaturbetriebs durch die Digitalisierung“ (S. 13) – denen nicht nur ein ganzer Abschnitt gewidmet ist, sondern die an vielen Stellen thematisiert werden – einen deutlichen Zugewinn. Gemeint sind vor allem die vielen anschaulichen Beispiele, die (manchmal scheinbar unbedeutenden) Randinformationen sowie die Art und Weise, wie Richter in das Thema einführt, die die Lektüre des Buches vor allem im universitären (und schulischen) Unterricht nicht nur rechtfertigen, sondern auch zu einem vergnüglichen Unterfangen machen. Selbst wer bereits eine Einführung in den Literaturbetrieb sein eigen nennt, ist gut beraten, sich auch ‚den Richter‘ zu besorgen.
Steffen Richter listet nicht nur Fakten, Daten und Akteure des „Literaturbetriebes“ auf und analysiert deren Zusammenwirken, sondern reflektiert dabei gleichzeitig die meist impliziten Überzeugungen, die hinter den beobachtbaren Gegebenheiten stehen. Den Literaturbetrieb versteht der Autor dabei zu Recht und wie die meisten anderen nicht als (mikro-)ökonomischen, sondern als soziokulturell makroökonomischen Begriff, das heißt „als die Gesamtheit der Institutionen, Instanzen und Personen sowie ihrer Beziehungen untereinander, die Rahmenbedingungen für die Produktion, Distribution und Rezeption literarischer Texte bilden“ (S. 8). Die Reflexion der genannten Überzeugungen passiert mit leichter Hand und unaufdringlich, wodurch das Buch erfreulich frei bleibt von theoretischem Ballast (der zwar für jede/n angehenden Literaturwissenschaftler/in auch bewältigt werden muss, aber woanders nachgelesen oder erworben werden kann). Durch das Reflektieren dieser Überzeugungen kann Richter elegant zeigen, dass der Literaturbetrieb genau so, wie er aussieht und sich entwickelt hat, nicht einfach natürlich oder vom Himmel gefallen ist, sondern auch ganz andere Wege hätte einschlagen können.
So versteht es Richter aufzuzeigen – um nur ein Beispiel zu nennen –, dass das Zusammenspiel zwischen Literatur als Kunst und als Ware auch deshalb immer spannungsgeladen war, weil die ökonomische Logik der Vermarktung und der pragmatischen Handwerklichkeit seit Jahrhunderten mit dem wirkmächtigen Bild der Künstlerin bzw. des Künstlers als kreativem Genie kollidiert. Die Erkenntnis ist natürlich nicht neu, aber sie kontextualisiert (und theoretisiert) Entwicklungen des Literaturbetriebes, die mit den üblichen Begriffen (Globalisierung, Spezialisierung, Professionalisierung, Personalisierung, Eventisierung, Beschleunigung etc.) – die auch Richter klarerweise thematisiert – alleine nicht angemessen erklärt werden können. In anderen Worten: Wer den Literaturbetrieb nicht gleichzeitig als Teil des Kunstsystems und des Wirtschaftssystems versteht und diese Gleichzeitigkeit nicht in der je spezifischen historischen Bedingtheit fasst, wird ihn nicht richtig zu fassen bekommen. Richters Buch ist es hoch anzurechnen, dass er gerade historische Entwicklungslinien kenntlich macht, denn nur diese können die Verfasstheit des Literaturbetriebes auch verdeutlichen.
Überzeugend ist Richters Einführung durch die Verwendung zahlreicher Beispiele, die nicht nur das Funktionieren des Literaturbetriebes anschaulich erklären, sondern die Lektüre auch spannend gestalten. So wird nicht einfach erläutert, wie der Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis organisiert ist und abläuft, sondern es wird erzählt, dass sich Reinald Goetz 1983 dort vor laufender Kamera die Stirn aufritzte und PeterLicht 2007 sein Gesicht nicht zeigte (S. 21/22) – und in welcher Form zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Formen des Spiels mit Präsenz und Absenz eine 25 Jahre dauernde Entwicklung von Aufmerksamkeitsökonomien steht. Es werden nicht einfach die verschiedenen Autorenvereinigungen und ihre Entwicklung dargestellt, sondern auch die Dynamik dieser Gruppen (etwa der Gruppe 47) geschildert. Und dabei erfährt man auch einiges an Interessantem zu Georg Klein, Andrea Maria Schenkel, Patrick Süskind, Thomas Pynchon, Peter Handke, Günter Eich, Günter Grass, Peter-Paul Zahl und vielen anderen Autorinnen und Autoren mehr.
Auch die lebendige Schilderung der diversen Debatten und Skandale zwischen Kritiker/inne/n und Autor/inn/en – etwa der Streit zwischen Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass oder jener zwischen Frank Schirrmacher und Martin Walser, die (Plagiats-)Debatte um Helene Hegemanns „Axolotl Roadkill“ und vieles mehr – vermögen die Mechanismen des Literaturbetriebes überzeugend darzustellen, dies umso mehr, als es Richter an keiner Stelle verabsäumt, die diesen Beispielen zugrunde liegenden Überzeugungen und Weltbilder mit in seine Darstellung einfließen zu lassen. Dass sich Richter auf den deutschen und deutschsprachigen Buchmarkt konzentriert, sei ihm gerne verziehen, zumal sein Buch für ein deutsches und deutschsprachiges Publikum geschrieben wurde und zudem auch allerlei Informationen bereithält, die auf der anderen Seite der Sprach- oder Nationengrenze zu finden sind.
Richter spart die Probleme des Literaturbetriebs – etwa die prekären Lebensverhältnisse der meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder die unterschiedlichen Abhängigkeiten im Bereich von Sponsoring und Literaturförderung – nicht aus, allerdings bedient er keineswegs die Ressentiments kulturpessimistischer Positionen, die nur mehr eine unheilvolle Ökonomisierung hinter literarischen Phänomenen zu entdecken können glauben. Ausgewogen hält der Autor in seiner Vorstellung des Literaturbetriebes die Mitte zwischen der nötigen Anerkennung marktwirtschaftlicher Überlegungen der beteiligten Akteure sowie der technischen Erneuerungen und der ebenso nötigen Kritik daran.
Die Gliederung des Buches (Autor, Literaturförderung, Literaturkritik, Verlagswesen und Buchhandel, Medien und Literaturbetrieb etc.) folgt durchaus klassischen Mustern – diese Feststellung ist jedoch nicht als Kritik zu sehen, im Gegenteil –, aber dabei berücksichtigt Richter auch neuere und neueste Entwicklungen des Literaturbetriebes: Neben Phänomenen der Digitalisierung, die bereits erwähnt wurden, wäre etwa auch die kurze Analyse von neueren mündlichen Formen der Literatur (Poetry Slam, Lesebühne etc.) zu nennen (vgl. S. 113ff.).
An dieser Stelle sei dem Rezensenten der einzige kleine Einwand erlaubt: Selbst wenn Richter zugesteht, dass viele qualitätsvolle Autor/inn/en auf Bühnen auftreten, erscheint mir sein Urteil doch zu hart, wenn er schreibt: „Wichtiger als der literarische Wert der Texte ist hier [Anm.: beim Poetry Slam] der Unterhaltungswert und eine stimmige Performance. Ebenso verhält es sich mit der verwandten Form der Lesebühne, wo festes Personal regelmäßig literarisch meist wenig ambitionierte Gebrauchstexte vorträgt.“ (S. 115) Schwerer als die fehlende Anerkennung für ausgezeichnete Lesebühnenautor/inn/en und Slampoet/inn/en wiegt hier eine Loslösung der literarischen Qualität von ihrer ‚Einkleidung‘ in ein mediales Gewand, sei es nun ein Buch oder eine Performance.
Mit einer Kritik soll die Rezension dieser empfehlenswerten Einführung jedoch nicht schließen, denn das hat diese nun wahrlich nicht verdient. Darum stehe am Ende der Rat: Das Buch gehört in jede Bibliothek!