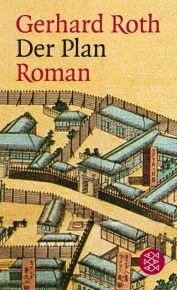Der Autograph wird Konrad Feldt, einem Mitarbeiter der Österreichischen Nationalbibliothek, zugespielt, zusammen mit der Adresse eines japanischen Antiquitätenhändlers, der bereit ist, viel Geld für das kostbare Stück Papier auszugeben. Geschickt arrangiert Feldt eine Vortragsreise nach Japan, um das Geschäft seines Lebens abzuwickeln.
Wie für viele Figuren Gerhard Roths ist auch Feldts Beziehung zur Welt distanziert, gefiltert durch Beobachtung und Reflexion. Als leidenschaftlicher Leser gerät ihm der Blick auf die Wirklichkeit zur Fiktion, die „absolute Erfüllung“ wäre es ihm, „lesend auf das wirkliche Leben zu verzichten“. Annäherungen an diesen Zustand hat es für Feldt von Kindheit an gegeben, immer dann, wenn sich ihm, von einem schweren Asthmaanfall körperlich geschwächt und geistig sensiblisiert, die Welt der Worte und Buchstaben, der Bücher und Bilder als sinnlich erfahrbare Räume darstellten. So ist Feldts Reise nach Fernost auch eine Reise durch das Innere eines bibliophilen Gehirns, dem sich die Welt als zu dechiffrierendes Zeichensystem offenbart.
Insofern bewegt sich Feldt auch im fernen Japan so, als wären Welt- und Ich-Erfahrung, Liebe, Angst und Tod ein Second-Hand-Erlebnis, das es immer schon irgendwo im „Tollhaus“ der Bibliotheken als Geschichte, Foto oder Bild gegeben hat.
Das Verschwinden des „authentischen“ Erlebens und damit eines jeweils an einzelne Subjekte gebundenen Wertesystems als Äquivalent zu einem begierig konsumierenden Egoismus darf wohl als subtile Zivilsationskritik verstanden werden.
Die Kriminalstory und der bildhaft stark inszenierte Tod des Bibliothekars Feldt im Inferno eines Erdbebens mögen ihrerseits Indizien sein, daß Welterfahrung heute immer schon eine mediale Interpretation von Wirklichkeit mitreflektiert.
All dies ist denkmöglich, durchzieht jedoch Roths Roman nur als lautloses Gedankengeflecht eines ruhig gewordenen Beobachters, kunstvoll im Hintergrund einer spannenden Story und sprachklarer Reisebeschreibungen verborgen.