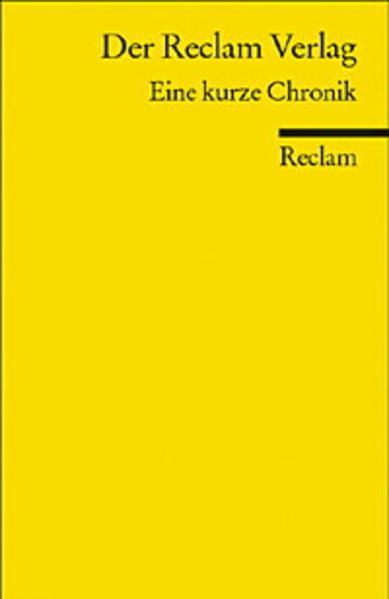Zwei kleine Bändchen im neuen, vielleicht ein wenig zeitgeistig schrillen Gelb sind zum Jubiläum erschienen, eine Kurzfassung der umfangreichen Verlagschronik aus dem Jahr 2003, und Die Welt in Gelb, ein Überblick zur Buchästhethik und Reihengestaltung der Universal-Bibliothek. Gelb ist die Reclam-Welt übrigens erst seit 1970, als man die alten Rosenholz-, Chamois- und Elfenbein-Schattierungen hinter sich ließ. Beide Bücher sind nicht nur ein Beitrag zur Verlagsgeschichte, sondern auch zur Geschichte der Buchkultur.
Verfasser der Chronik ist Frank R. Max, seit 1998 Geschäftsführer des Verlags und nach dem Ausscheiden Dietrich Bodes 1999 Geschäftsführer des Gesamtbetriebs. Irgendwie liegt der Gedanke nahe, dass die anhaltende Erfolgsgeschichte des Verlags auch mit der sympathischen, intelligent-zurückhaltenden Art seiner Leitungsfiguren zu tun haben könnte.
In den Anfängen geriet der 1837 von Anton Philipp Reclam gegründete Verlag rasch in die vormärzlichen Unruhen und in Konflikte mit der Zensur. Die Wendung zum Klassischen mit dem Start der Universal-Bibliothek hatte dann ursächlich zu tun mit einer Institution, die gerade gekippt werden soll: dem Urheberrecht. 1867 lief die 70-jährige Schutzfrist für die Klassiker aus und so wurde mit Goethes „Faust I“ die Reihe im handlichen Format eröffnet. Sie wuchs rasch und kontinuierlich, 1878 war man bei Nummer 1.000, 1885 bei 2.000, 1899 bei 4.000 angelangt. Pünktlich mit dem Ablauf der Schutzfrist 1903 kam Franz Grillparzer an Bord. 1908, die UB hielt bei Nummer 5.000, entwarf Peter Behrens – von ihm stammt auch das Segelschiff des Insel-Verlags – ein neues Erscheinungsbild für die gebundenen Bände, und er designte vier Jahre später auch Reclams legendären Bücherautomaten, von dem bis 1917 fast 2.000 in Dienst gestellt wurden, die bis 1940 in Einsatz blieben.
Beim 50-jährigen Jubiläum der UB 1917 war der absolute Spitzenreiter Schillers „Wilhelm Tell“ und der führt die „Top Ten seit 1948“ (Die Welt in Gelb, S. 65) nach wie vor an, gefolgt von Goethes „Faust“, Kellers „Kleider machen Leute“, Lessings „Nathan“ und Droste-Hülshoffs „Judenbuche“ – ein getreuer Spiegel der Schullektüre der Nachkriegszeit.
1933 erreichte die Säuberungsliste des Börsenvereins natürlich auch den Reclam Verlag – Hermann Hesse weigerte sich 1933 übrigens standhaft, seine „Bibliothek der Weltliteratur“ in rassisch bereinigter Form neu aufzulegen. 1946 begann der Neustart in Leipzig, 1947 in Stuttgart, und damit schrieb sich die deutsche Nachkriegsgeschichte tief in die Verlagsbiografie ein – bis hin zur Abwicklung der östlichen Reichshälfte. Es dauerte übrigens bis 1959, bis die UB wieder bei Nummer 1.000 angelangt war, bis heute aber gilt: „An der Fortsetzung dieser Sammlung wird unausgesetzt gearbeitet.“ (Chronik, S. 11)
Wie sich die Verlagsästhetik im Verlauf der Zeit verändert hat, ist der „Welt in Gelb“ zu entnehmen. Überraschenderweise am wenigsten informativ ist hier vielleicht der Beitrag zur Geschichte der Neugestaltungen, der vom Graphiker des durchaus geglückten Relaunches von 2012 stammt, und über Seiten hinweg nur Annemarie Meinerts Untersuchung aus dem Jahr 1942 (neu 1958) zitiert. Sehr unterhaltsam sind hingegen die kleineren Beiträge, etwa zum 2012 deutlich aufgefrischten Farbspektrum der Reihen, die sich über die Jahre herausbildeten: 1969 starteten die grünen „Erläuterungen und Dokumente“, 1970 die orangen Textausgaben in Originalsprache und deutscher Übersetzung, 1983 die roten Fremdsprachentexte. Dass das Preis-Punkte-System 1991 abgeschafft wurde, hat nichts daran geändert, dass es in den Köpfen der Reclam-Leser immer noch herumspukt. Besonders anregend sind die abschließenden Beiträge zu den sekundären Nutzungseffekten der populären Reihe in Gestalt diverser (Alltags-)Kunstprojekte.