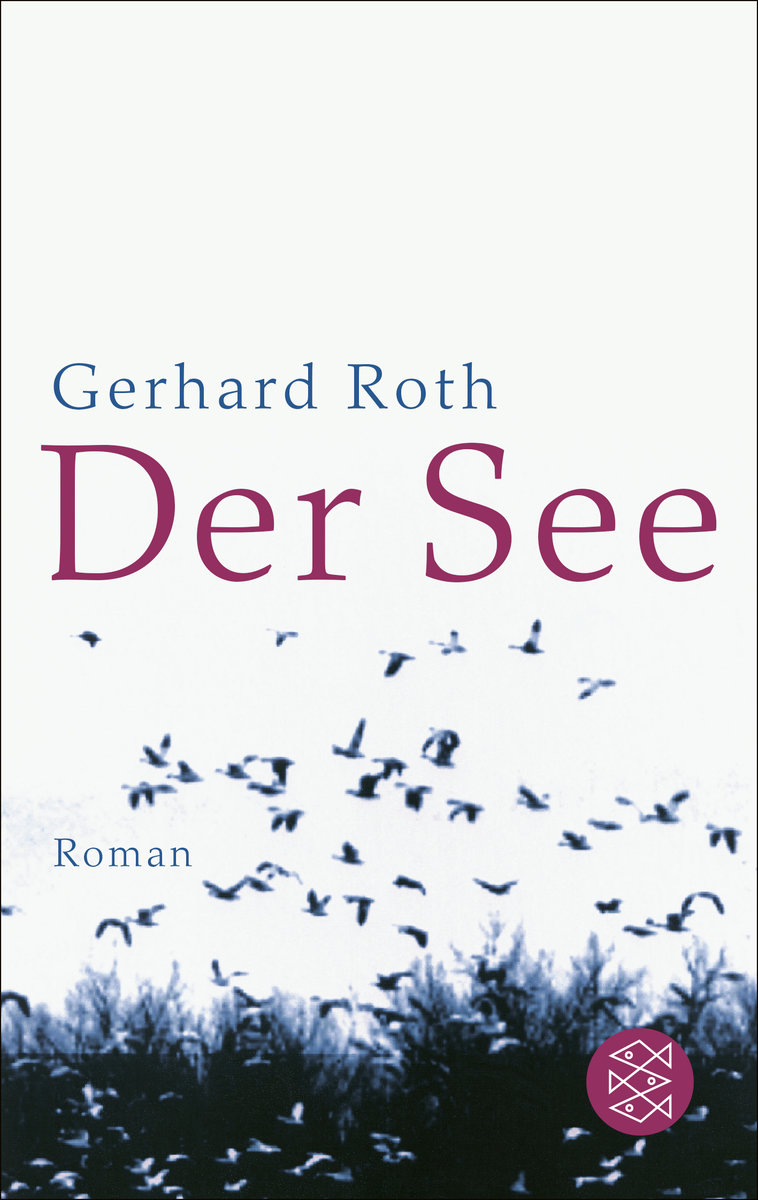Gerhard Roths Der See beschreibt das politische – und ganz allgemein das gesellschaftliche – Klima in Österreich als ein sowohl latent wie auch zunehmend manifest gewalttätiges. Den drei Motti des Buches stellt der Autor eine Überschrift voran: „Im Land der Mörder“ – so könnte gleichzeitig auch der Untertitel des Romans lauten. Hier wimmelt es von zwielichtigen Figuren und Ereignissen, die, durch die Perspektive des medikamentensüchtigen Protagonisten betrachtet, nicht gerade an Klarheit gewinnen.
Die 1997 unter der Regie von Thomas Roth, dem Sohn des Autors, entstandene und vom ORF produzierte filmische Adaption des Romans wurde nunmehr in die Kinos geschickt, um dort zu demonstrieren, daß Literaturverfilmungen nicht fad sein müssen. Als wären die Aufregungen um den Roman Gerhard Roths und um die Entstehung des Films – ursprünglich sollte ja Ulrich Seidl die Regie übernehmen – nicht laut genug gewesen, ist nun auch der Film selbst zu einem Produkt geraten, der mit jedem Bild und jedem Ton aggressiv um Aufmerksamkeit ringt.
Bis auf den Rumpf des Plots hat der Regisseur vom literarischen Text kaum etwas ins Medium Film mitgenommen. Thomas Roths Der See forciert das Spektakel auf allen Ebenen, wofür die (Rausch-)Zustände Paul Ecks (Gabriel Barylli) das beste Motiv zu bieten scheinen. Was auf einen ersten wohlwollenden Blick noch als ausgeprägter Wille zum stilistischen Experiment durchgehen mag – extreme Großaufnahmen, Manipulationen an Farbe und Körnung des Filmmaterials, (vermeintlich) kühne Schnitte, frenetische Kamera-Kran-Fahrten etc. – läßt sich in kein Verhältnis zu Gerhard Roths betont einfacher, sachlicher Sprache bringen. Dieser Film ist voller Übertreibungen und Leerläufe – auch jenseits der technischen Exzesse: Weshalb müssen aus Ecks Wohnwagen-Genossen, den Silberfischchen, im Film Kakerlaken werden? Weshalb muß die Kamera während des ersten Gesprächs Ecks mit seinem Jugendfreund Robert dessen Frau bei einem Gang durch das Haus folgen?
Von der politischen Brisanz des Romans ist im Film nicht viel übrig geblieben. Die Aneinanderreihung von optischen und akustischen Effekten verhindert denn auch eher, daß die Dinge „zu sprechen anfangen … von selbst“ (S. 155) – wie sie das im Roman Gerhard Roths durchaus immer wieder tun.