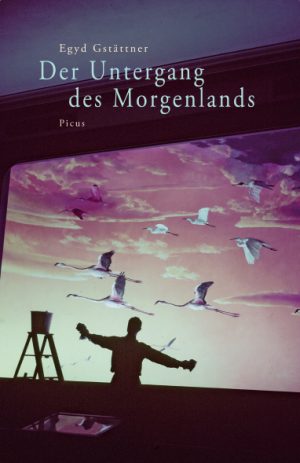Ein wiedergeborener Messias predigt da eine so ganz andere Heilslehre und wird prompt vom himmlischen Vater abserviert. Ein Herr Musil bleibt auf Lebzeiten in Kärnten stecken, wo ihn das geistige Klima zu einer Ansammlung von Komplexen und Ressentiments verkümmern lässt. Ein bayrischer Berghotelier des neunzehnten Jahrhunderts gerät in einen visionären Taumel, der ihn weit in die Zukunft gastronomischer Irrsinnigkeiten blicken lässt, und wird erst in letzter Sekunde von den Widrigkeiten seiner Gegenwart aufgehalten. Ein österreichisches Polizeirevier verfolgt höchst erfolglos die Spuren verschiedener Morde und führt dabei eine Groteske zwischen Chronik-Berichterstattung, Promi-Kochsendung und Ratgeberlektüre auf. Ein tragisch verunfallter Landeshauptmann überwacht aus dem Grab die Umtriebe seiner Getreuen und blickt auf sein Leben zurück.
In Gstättners Erzählungen tummeln sich alltags- und zeitungsbekannte Gestalten, Heils- und Untergangsbringer, Heuchler und Wahrhaftige, und alle zeigen sie sich von ihrer besten, das heißt von ihrer schlechtesten Seite. Hinreißend ist, wenn Gstättner weissagt, dass der „Mann ohne Eigenschaften“ in Kärnten ein Heftchen von kaum achtzig Seiten geworden wäre. Zwar metrisch nicht immer astrein (aber was soll’s), dafür herrlich boshaft ist sein gotteslästerliches Potpourri aus Kirchenlied und Voltaire zum Tsunami von 2004: „Die, die nicht ersoffen sind / sind nach wie vor vom Hoffen blind. / Zweihunderttausend Todesopfer / ändern nichts an ihrem Klopfer.“ Mit viel Geschick handhabt Gstättner die unterschiedlichsten Blickwinkel und Motive, setzt er literarische, religiöse und historische Bezüge, verschießt er böse Pointen.
Das Gekonnte, Routinierte allerdings stellt bisweilen auch das Manko mancher Episoden dar. Zu viele von ihnen beziehen ihren Witz aus ähnlichen Handgriffen: etwa einer historischen „Was wäre wenn“-Frage; oder einer Erzählperspektive, die sich erst gegen Ende zur Gänze offenbart und dadurch dem Erzählten den entscheidenden Dreh verpasst. Die Icherzählung des wiedergeborenen Messias oder das Bekenntnis von einem, der „ganz sicher kein Rassist“ ist, funktionieren so. An anderer Stelle muten einige der wohlgesetzten Pointen recht naheliegend an. So ist die Geschichte über die großen und kleinen Ungeheuerlichkeiten nach dem Unfalltod des Kärntner Landeshauptmanns durchaus interessant, der selbstherrliche, ja größenwahnsinnige Ton der Kärntner „Sonne“ beißend getroffen; auf die Dauer wirkt der Text jedoch eher gut recherchiert als wirklich fesselnd.
An denselben Stellen werden paradoxer Weise auch die großen Stärken dieser Prosa sichtbar: Gstättner versteht sich auf absurde Versuchsanordnungen, auch zeigt er sich als begnadeter Entlarver der Jargons, der seichten Sprachmasken und menschenverachtenden Rhetorik. Wirklich großartig wird er jedoch erst dort, wo seine Arrangements über die Aussage, seine Sprachmaskeraden über das Parasitär-Satirische hinausgehen. Atemberaubend inszeniert ist das Verenden des bayrischen Berghoteliers an der Cholera, inmitten von Weltuntergangsstimmung und Bernhard’scher Kulturbetriebssuada, berückend friedlich der sinnlose Tod eines amerikanischen Industriellensohns im österreichischen Skigebiet, aberwitzig der Tanz phrasendreschender Polizisten zur Vertonung von Wittgensteins Tractatus. Hier entwickeln die Texte einen manchmal zarten, manchmal taumelnden, manchmal absurd komischen Sog.
Und so verkehrt oder grotesk überzeichnet die Verhältnisse oft auch sind, so findet man sich doch unvermittelt in verflixt bekannten Szenerien wieder, ist das Ungeheuerliche oft nicht mehr als eine Winzigkeit von der Realität entfernt. Die Frage nach dem Wiedererkennen einer verkehrten, unsinnigen Welt beantwortet Gstättner so höchst sinnig: Wir würden den Unterschied wahrscheinlich kaum bemerken. Sofern es wirklich einen gäbe.