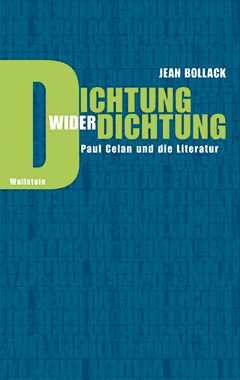Sein Nachdenken über und mit Paul Celan stützt sich indessen auf einige wenige, gut nachvollziehbare Thesen. Im Vorläuferwerk mit dem ebenfalls prägnanten Titel „Poetik der Fremdheit“ hatte Bollack die unversöhnbare Stellung des Dichters gegen eine Welt nachvollzogen, in der seine Familie ausgerottet wurde. Die Judenvernichtung war mit dem Kriegsende nicht vorbei. Die Dichtung Celans bleibt in ihrer Gesamtheit und in jedem einzelnen Text auf das historische Ereignis bezogen. Dichtung wider Dichtung beschäftigt sich mit Traditionslinien, literarischen Kontexten und intertextuellen Beziehungen. Zu diesen Thesen kommt eine weitere, mehr sprachbezogene: im Kern ist das dichterische Verfahren, das Celan beim Aufbau seiner Gegensprache verwendet, ein Verfahren der Resemantisierung, also der Um- und Neuwertung von zumeist deutschen Wörtern und Ausdrücken unter den Bedingungen des erfahrenen und erlittenen Mißbrauchs der Sprache durch den Nationalsozialismus und, darüber hinaus, den deutschen Militarismus, den Bollack nicht nur in militärischen Kreisen am Werk sieht. „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, dieses berühmte Gedichtfragment wird auf die gesamte deutsche Geschichte, Literaturgeschichte mit eingeschlossen, projiziert.
Auch wenn Bollack immer wieder auf die Singularität Celans pocht – seine Untersuchungen unterscheiden sich nicht grundsätzlich von traditionellen Studien zu Einflüssen, denen sich ein Autor geöffnet oder die er erlitten hat. Es ist immer ein Spiel von Öffnung und Abwehr, die Einflüsse können für den Autor und sein Werk bedrohlich werden oder ihm helfen, den eigenen Weg zu finden. Im Grunde gelangt man von derlei Überlegungen sehr schnell zum Plagiatsvorwurf, der in Gestalt der „Goll-Affäre“ Paul Celan niedergedrückt hat und den anders als im Zusammenhang antisemitischer Verfolgung zu berücksichtigen Bollack sich scheut. Die Goll-Affäre, ein fruchtbares Feld für Positivisten der Literaturgeschichte, läßt sich als poetologisches Argument leicht vom Tisch wischen; Ingeborg Bachmann versuchte, das zeigt der unlängst veröffentlichte Briefwechsel zwischen ihr und Celan, ihren Freund davon zu überzeugen, daß derlei Vorwürfe tief unter seinem Niveau waren und er ihnen nur Nahrung gab, wenn er ihnen so viel Beachtung schenkte. Bollack bezeichnet Bachmanns Verhalten als kompromißlerisch. Mag sein, daß die im männlichen Literaturbetrieb sich Behauptende mehr zu Kompromissen bereit war. Mag auch sein, daß Celan nicht anders konnte und sich immer tiefer in das paranoide Dickicht begeben mußte. Die Spätwirkungen antisemitischer Verfolgung und die persönliche, nicht durch Geschichtliches erklärbare psychische Disposition sind miteinander verstrickt, beides läßt sich im nachhinein nicht mehr trennen. Daß beide Faktoren gegeben waren, bestätigen die Dokumente der Goll-Affäre und der Briefwechsel mit Bachmann.
Ist der Tod ein Meister aus Deutschland? Soll man den poetischen Satz als Schlußsentenz deutscher Geschichte interpretieren? Heißt das nicht, sich in ein Fahrwasser zu begeben, das man eigentlich meiden will: das Fahrwasser nationaler, gar „völkischer“ Genetik, des urdeutschen, unausweichlichen Schicksals? Bei Rilke meint Bollack eine „tötende Sprache“ zu finden, der ewig kränkelnde Dichter, Verehrer slawischer und romanischer Kultur, Verfasser zahlreicher französischer Gedichte, der 1914, als die meisten deutschen Schriftsteller in Kriegsjubel verfielen, als einzigen „Kommentar“ zum ersten Weltkrieg seine eher distanzierten, nachdenklichen „Fünf Gesänge“ schrieb, sollte den zweiten Weltkrieg mit vorbereitet haben? Sein „Cornet“, in erster Linie eine große Liebesdichtung und in mythisch-geschichtlicher Ferne schweifend, soll später die Wehrmachtsoldaten angefeuert haben? Derlei Behauptungen findet man bei Bollack; daß Celan ähnlich gedacht haben soll, ist anhand der beigebrachten Gedichtstellen nicht nachzuvollziehen. Die „große Dichtung der Vergangenheit“, liest man, hat „selber zur Vernichtung das Ihre beigetragen“. Bollack suggeriert, daß es sich dabei um die deutsche Dichtung handelt (der er die österreichische zuschlägt). Ein rascher Blick auf andere Literaturgeschichten genügt, um zu erkennen, daß auch diese nicht gegen Gewaltverherrlichung gefeit sind, auch wenn diese Strömungen minoritär sind. Man denke an Céline oder, um einen genuinen Dichter zu nennen, an Ezra Pound. Ein wenig vorsichtiger als im Fall Rilkes wirft Bollack Friedrich Hölderlin seinen Gebrauch durch die Nazis vor, der, selbst wenn man von „Mißbrauch“ spricht, doch etwas über das Werk selbst aussage. Zusammenfassend und mit wünschenswerter Deutlichkeit schreibt Bollack: „Die Gründe für den der ‚Todesfuge‘ neu zugewiesenen Ort erfaßt man, wenn man erkennt, daß das Morden, das Talent, der Hang und die Lust dazu, auf die frühere kulturelle Tradition Deutschlands bezogen werden, zurück bis auf die Kunst des Kirchenlieds und auf den ‚Faust‘, aber auch auf die ‚Walküre‘ und das ‚Rheingold‘. Der Tod ist ein ‚Meister‘, ein Meister der Dichtung und des Gesangs. In dieser Tradition lernte man zu lieben und zugleich, Jüdinnen zu töten.“ Wer auch immer das Subjekt sein mag: Luther, Paul Fleming oder Richard Wagner, Goethe, Faust oder Gretchen – es besitzt „Talent“, einen „Hang“ sowie „Lust“ zum Töten. Wie abwegig derlei Formulierungen sind, merkt man, wenn man Gretchen, also ein mißbrauchtes Mädchen, das sich in seiner Verzweiflung selbst tötet, an die Subjektstelle setzt. Die „Margarete“ der Todesfuge ist ein deutscher Symbolname wie Sulamith ein jüdischer. Mag sein, daß Celan auf Goethes „Faust“ anspielt. Daß Goethe (unbewußt oder wie auch immer) auf die Judenvernichtung hingearbeitet haben soll, steht nicht im Gedicht, Bollack trägt diese Idee in es hinein.
„Die Dichtung allgemein, und gerade auch Rilke, wie er während des letzten Krieges verwendet wurde, und gerade die Züge, die durch diese Verwendung bloßgestellt wurden, hatten einen Anteil an der Vorbereitung des Geschehenen“ – gemeint ist die Judenvernichtung. Diese Formulierung ruft förmlich nach einem Kommentar, den Gottfried Benn (in den Augen Bollacks zweifellos ein Kompromittierter) noch in Kriegszeiten tätigte: „Die Duineser Elegien kann man bestimmt von allen Seiten betrachten, so vielfältig sind sie, aber sie in irgendeinem noch so versteckten Sinne als militaristisch zu deuten, rückt sie in eine schiefe Beleuchtung. Der Bezug auf Rilke ist also eine reine Bauernfängerei für die (…) allmählich schwachsinnig gewordene deutsche Intelligenz.“ Einen Intellektuellen wie Bollack als Bauern zu qualifizieren, wäre natürlich Unsinn; Benns impulsive Äußerung, getätigt in einem von der Intelligenz weitgehend verlassenen Land, möchte ich ihm dennoch zu bedenken geben. Tatsächlich war Rilke im Dritten Reich für Leute, die sich im (oft religiös motivierten) Widerstand oder in der inneren Emigration befanden, eine Identifikationsfigur. Egon Schwarz hat in seinem Aufsatz „Rilke unter dem Nationalsozialismus“ diese ambivalente Rezeption nachgezeichnet. Hinweisen möchte ich außerdem darauf, daß eines der letzten Werke des jüdisch-österreichischen Komponisten Viktor Ullmann eine Vertonung von Rilkes „Cornet“ ist, angefertigt im Konzentrationslager Theresenstadt kurz vor seinem Transport nach Auschwitz, wo er ermordet wurde.
Von all den Autoren, denen in Bollacks Studie ein längerer Abschnitt gewidmet ist, gesteht Bollack am ehesten Ingeborg Bachmann so etwas wie dialogische Gemeinsamkeit mit Celan zu. Doch um Celans Wunsch nach einer gegen die feindliche Umwelt resistente und von ihm, dem männlichen Part, dominierte Symbiose dauerhaft zu erfüllen, besaß Bachmann, Bollack zufolge, nicht genügend Radikalität. Wäre Bollack bereit, den anderen Autoren ein wenig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen (was allerdings bedeuten würde, daß er die These von der absoluten Singularität Celans zumindest relativieren müßte), könnte er eine größere, nicht ausschließlich biographisch konstituierte Gemeinsamkeit, eine Art literaturgeschichtlicher Schnittmenge rund um die Aktualisierung des Orpheus-Mythos bei Rilke, Bachmann und Celan entdecken. Natürlich bezieht sich das Motiv bei Bachmann und Celan vor allem auf die Judenvernichtung, die Rilke nicht vorausahnen konnte. Bollack zieht es vor, den „Sonetten an Orpheus“ einen mörderischen Todeskult zu unterstellen, während er in Celans Gang in die Unterwelt, seinem Ausharren bei den Toten, das Um und Auf einer nicht nur konsequent antifaschistischen, sondern von Grund auf erneuerten, zugleich krisenhaften Dichtung sieht. „Dunkles zu sagen“ ist der Titel eines an Celan gerichteten Bachmann-Gedichts. „Dunkel“ bzw. „Dunkles“ ist eines jener vorsichtigen Wörter, die sich durch den gesamten Briefwechsel zwischen den beiden ziehen. Ein anderes, zwar selteneres, aber nicht weniger bedeutsames ist „hell“, „Helles“. Celan rang durchaus, sosehr er seine Gedichte als Totengedenken verstand, um Helligkeit, und Bachmann, selbst vom Dunkel bedroht, wollte ihm in diesem Kampf beistehen. „Worte finden“: die Hell-Dunkel-Semantik wirkt im Verlauf des Briefwechsels fast trivial. Daß Bachmann vielleicht etwas entschiedener als Celan zum Hellen strebte, mag man als Zeichen von Schwäche abtun. Im Gedicht spielt der weibliche Orpheus zunächst „auf den Saiten des Lebens den Tod“, doch am Ende hat die Kraft des Gedichts eine Inversion bewirkt: „wie Orpheus weiß ich / auf der Seite des Todes das Leben“. Aus der „Saite“ ist, fast ein Kalauer, eine „Seite“ geworden.
Bollack qualifiziert die österreichische Autorin einmal als „Mittelwegdichterin“, ihre Dichtung habe eine Tendenz zum „Beliebigen, Eklektischen und Amorphen“. Solche Aussagen sind eindeutig abwertend gemeint (auch wenn man sich fragen kann, ob eklektische und amorphe Dichtung nicht wertvoll sein kann, und weiters, ob diese Epitheta nicht eher auf Celan als auf Bachmann zutreffen). Die Absolutsetzung von Celans Singularität führt Bollack unweigerlich dazu, die anderen Autoren abzuwerten, manchmal sogar: abzukanzeln. Rilke hatte eine „etwas hilflose und gespaltene Gefühlswelt“, und seine Dichtung „war vielleicht gar nicht dichterisch“. Dieser Wille zur Abwertung geht einher mit einer Tendenz zu apodiktischen Behauptungen, die oft mit autoritärem Gestus vorgetragen werden. „Der Tod läßt sich nicht mehr elegisch beklagen“: das Genre, von Hölderlin und Rilke gepflegt, kann bei Celan nicht fortleben. Die „Umkehrung der poetischen Tradition ist die obligate Perspektive jeder (!) Interpretation Celans.“ Derlei Aussagen bestreiten implizit die Möglichkeit des Zweifels. In seiner Selbstsicherheit versteigt sich Bollack zu höchst zweifelhaften Behauptungen. Beispiel: Ingeborg Bachmann habe die Lyrik aufgegeben, weil sie von „Sterbenswörtern“ genug gehabt habe; mit der Prosa habe sie sich dem Leben zugewandt. Doch der Romanzyklus, an dem sie während der letzten Jahre ihres Lebens arbeitete, heißt „Todesarten“, und Lebensfreude ist nicht gerade das, was in „Malina“ oder in „Der Fall Franza“ vorherrscht.
Wahrscheinlich kennen wenige Leser Celans Werk so gut wie Bollack, der einst mit Celan befreundet war und wie Peter Szondi einzelne Gedichte aus seiner persönlichen Kenntnis biographischer Umstände erhellen konnte. Deshalb verwundert es, wie unmethodisch und sorglos er immer wieder einzelne Celan-Texte bespricht. Mitunter kommt er zu willkürlichen Schlußfolgerungen und Sinnzuschreibungen, die seine Hauptthesen bestätigen sollen. Andererseits werden ganze Texte, ja Zyklen leichtfertig bewertet und in fragwürdige Zusammenhänge gestellt, so zum Beispiel, wenn die „Niemandsrose“ als Antwort auf die Duineser Elegien hingestellt wird: Nur weil in Celans Gedichtband auch Engel vorkommen? In einem der letzten Verse ist dort von „Erzengelfittichen“ die Rede – aber Rilke hatte sich ausdrücklich dagegen verwahrt, seine Engel als christliche zu interpretieren. Der von Bollack angedeutete Zusammenhang ist nicht nachvollziehbar. Weit sinnvoller könnte man, was verschiedene Interpreten ja schon getan haben, die engen Bezüge zum Werk Ossip Mandelstamms – „der Name Ossip kommt auf dich zu“ – herausstellen; bezeichnend, daß dieser Name im Buch Bollacks, das im Untertitel das Thema „Paul Celan und die Literatur“ stellt, nur ganz am Rande vorkommt. Der Bruder und Dialogpartner im Geiste der Poesie paßt nicht zum Begriff der Kampfdichtung, auf den Bollack Celans Werk reduziert.
Öfters geschieht es, daß Bollack in seinem Eifer entstellend zitiert. So wird zum Beispiel der „Glanz / aller Gedichte“, der „uns fast tödlich träfe“, zum buchstäblich „tödlichen“ Glanz – ohne „fast“ und ohne Konjunktiv –, der von Rilkes eigener Dichtung ausstrahlt. Rilkes Gedicht, es handelt sich um „Früher Apoll“, sagt aber durchaus nicht, daß Dichtung töte, und wenn, dann gewiß nicht im Sinn von Mord. Bollack unterstellt Celan, Rilke auf diese Weise interpretiert zu haben. Um seine Aussage zu stützen, bemüht er die letzten beiden Strophen von „In der Luft“, dem Schlußgedicht der „Niemandsrose“. Einen Bezug zu Rilke kann ich hier beim besten Willen nicht finden; wohl aber zu Brecht: die „Schwestern“ und „lebenslang Fremden“ seien mit der „Weltwaage“ im „blut- / schändrischen, im fruchtbaren Schoß“ zu leicht befunden worden. Die Anspielung auf die Judenvernichtung ist so unüberhörbar wie das Brecht Zitat – aber was hat das mit Rilke zu tun? Bollack hat seine eigene, fahrlässige Interpretation von „Früher Apoll“ dem Celan-Gedicht unterschoben.
Bollacks Brückenschläge zu Nationalsozialismus, Angriffskrieg und Judenvernichtung haben etwas Zwanghaftes, er entdeckt Zeichen an allen Orten und Enden. In gewisser Weise führt er damit Celans Verfolgtheit und Verfolgungswahn fort, der gegen Ende der fünfziger Jahre immer deutlichere Konturen annahm. Ob man Celan und seinem Werk damit jedoch etwas Gutes tut? Beschränkt man es auf diese Weise nicht auf einen – zweifellos vorhandenen und wichtigen – Aspekt? Celans Gedicht „Tübingen, Jänner“, das im Zentrum des Hölderlin-Kapitels von Bollacks Buch steht, ist zweifellos eine Auseinandersetzung mit dem großen Dichter, der jahrzehntelang im Wahn dämmerte. Auch der Bezug zur Wannseekonferenz, die im Jänner 1942 stattfand, ist nachvollziehbar. Bollack ergeht sich dann aber in phonetischen Assoziationen, die ihn von Tübingen zum französischen „tue“ (von „tuer“, töten) weiter nach Bingen (Tue-Bingen) und damit zu Stefan George bringen, der dort geboren wurde. Bollack landet also wieder einmal bei seinem Lieblingsthema, der deutschen (Literatur-)Geschichte als Todesgeschichte. Daß George, der für Celan keine große Bedeutung hatte, hier einzuordnen sei, setzt er als selbstverständlich voraus. George, Verfasser eines Gedichtbuchs mit dem Titel „Das neue Reich“ (1928, ein Spätwerk), als Vorläufer der nationalsozialistischen Ideologie: das ist, in solcher Pauschalitat, freilich nur ein, auch unter Germanisten verbreitetes, Gerücht. Ähnlich klischeehaft ist Bollacks Interpretation des Turms als Feudalismus-Symbol. Bei Celan sind es „schwimmende Hölderlintürme“, im bewegten Wasser vervielfacht sich der eine Turm, in dem Hölderlin wohnte. Für Bollack sind damit aber gleich „die Leiden der feudalen Unterdrückung“ angesprochen, die, so kann man zwischen den Zeilen lesen, in die Richtung der Wannseekonferenz, also der Judenvernichtung, deuten. Wer zu so kühnen Assoziationen nicht bereit ist, wird von Bollack des Verdrängens bezichtigt. Philippe Lacoue-Labarthe, der, horribile dictu, Heideggers Existentialismus an Celans Gedichte heranträgt, wirft er eine „forcierte, fanatische (!) Umgehung der NS-Geschichte“ vor.
Daß Celans Werk eine Art Kampfdichtung im Nachkriegskontext ist, kann man einräumen. Sie ist aber nicht nur das, und gerade die Beschäftigung mit anderen Dichtern, vor allem auch die Übersetzungen, drückt seinen Wunsch nach Brüderlichkeit, nach Geschwisterlichkeit aus – siehe auch die Versuche, die nur kurz währende erotische Beziehung zu Ingeborg Bachmann durch eine andere, geschwisterliche zu ersetzen. Daß die Wünsche sich im Leben noch weniger als in der Literatur verwirklichen ließen, steht auf einem anderen Blatt. Sowohl Ingeborg Bachmann als auch Gisèle Lestrange wollten ihm, dessen schweres Leiden sie beide erkannten, „helfen“ – beide gebrauchen dieses Wort. Im Brief, den Gisèle nach Celans Selbstmord an Ingeborg schrieb, steht der Satz: „Je n’ai pas su l’aider comme je l’aurai voulu“, „Ich konnte ihm nicht helfen, wie ich es gewollt hätte.“ Eine Hauptschwierigkeit beim Helfen bestand darin, daß Celan unbedingte Loyalität forderte. Im Kampf gegen die „Hitlerei, Hitlerei, Hitlerei“ (so beginnt ein Brief an Max Frisch) hatte man auch in Ermessensfragen auf seiner Seite zu stehen, oder man wurde zu seinem Feind. So konnte es geschehen, daß er seine engsten Vertrauten ein Stück weit in seinen Wahn hineinzog – dagegen, gegen diesen „Untergang“, und nicht gegen eine abstrakte „Radikalität“, wehrte sich Bachmann, ohne ihren Freund deshalb gleich aufzugeben. Während seiner letzten Lebensjahre, als auch seine Dichtung eine beispiellose Härte und Schweigsamkeit gewann, versuchte Celan zweimal, seine Frau zu töten. Bollack spricht sich dagegen aus, Celans Pathologie mit seinem Werk in Verbindung zu bringen. Dem Rezensenten hingegen will scheinen, daß dieses Werk ohne die Pathologie und ihre Ursachen nicht voll verstanden, nicht ganz ausgeschöpft werden kann. „Celan wurde an einem 23. November im Zeichen des Schützen geboren. Er leitete seine streitbare Ader von diesem Sternbild ab, stand zu dieser Geburt im Zeichen des Kriegs, sah sich als der Schütze mit schwirrenden Pfeilen.“ Offenbar greift Bollack auf seine persönliche Bekanntschaft mit dem Dichter zurück, wenn er diese Selbsteinschätzung Celans mitteilt. Auch wenn man, wie der Rezensent, Horoskopen wenig Bedeutung beimißt, kann man verstehen, daß ein der Judenvernichtung mit knapper Not Entronnener sich nicht ohne weiteres vom Krieg verabschieden kann. Bollack führt die polemische Ader weiter, er hält dem Schützen lange nach dessen Tod und dem historischen Kriegsende die Treue. Celan „hatte sich geschworen, in seiner Dichtung Rache zu üben an den an den Juden begangenen Verbrechen. Der Haß lag seiner Dichtung zugrunde.“ Ja, aber doch wohl in erster Linie der Haß gegen die Verbrecher, nicht – oder nur im Wahn – gegen die gesamte Literaturgeschichte. Der sekundierende Schütze gibt sich eifriger als sein Vorbild, und er schießt weit weit über das Ziel hinaus.
Auf Ossip Mandestamm habe ich hingewiesen, andere von Bollack vernachlässigte Dichter wären zu nennen. Sogar Nietzsche, diesem großen Hasser, mit seinem Sozialdarwinismus noch am ehesten ein Vorläufer der Nazi-Ideologie, und Heidegger, der eine Zeitlang mit den Nazis gemeinsame Sache machte, konnte er etwas abgewinnen. Emmanuel Lévinas, wie Celan und Mandelstamm jüdischer Herkunft, hat in einem Text, der vor allem Celans Büchnerpreisrede auswertet, das Gedicht als „Händedruck“ definiert, d.h. als (sprachliche) Geste, die der Geste des Kriegers genau entgegengesetzt ist. Das Gedicht „hält unentwegt auf jenes ‚Andere‘ zu, das es sich als erreichbar, als freizusetzen, als vakant vielleicht, und dabei ihm, dem Gedicht (…) zugewandt denkt“, sagte Celan 1960 in seiner Rede. Bollack jedoch bestreitet, daß „Gespräch“ bei Celan „Dialog“ bedeutet. Aus der Intersubjektivität, die Celan verzweifelt suchte, macht Bollack eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Dem steht ein anderes Konzept gegenüber, das beides in seiner Differenz zu vereinen trachtet: die singuläre Einsamkeit vor einer unzugänglichen oder feindlichen Welt und den freien Austausch selbstbestimmter Subjekte. Celans Dichtung ist hermetisch und dialogisch; sie schließt sich ab und sie öffnet sich; sie ist einsam und, trotz allem, kommunikativ. Die Kunst des Interpretierens bestünde darin, beide Seiten zusammenzusehen.