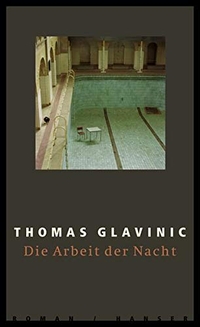Die Arbeit der Nacht nennt es sich und wird als Roman bezeichnet. Eine Klassifikation, die zutrifft, wenn man mit Fritz Martini den Roman als eine Erzählung begreift, „in der vom Persönlichen aus das Ganze des Weltseins erfahren wird oder erfahren werden soll“. Vielleicht sollte man bei Glavinic noch das Attribut „Science Fiction“ davor setzten. Denn er zeigt den Einzelnen in einer alternativen, um nur einen Parameter veränderten Welt. Diese Welt gleicht in allen Wesenszügen der uns bekannten – bis auf den Umstand, dass sie entvölkert ist. Diese minimale Verschiebung generiert eine maximale Spannung. Die tier- und menschenleere Vedute Wien liefert das experimentelle Setting für eine Geschichte, in der ein allmächtiger Autor seiner Schöpfung beim Überleben zusieht. Und dieses Zusehen ist durchaus wörtlich zu verstehen: Mit dem Motiv des unsichtbaren, nichtsdestotrotz präsenten Beobachters spielt Glavinic den ganzen Roman hindurch.
Die Arbeit der Nacht kommt – und das ist außergewöhnlich – mit einer einzigen Figur aus, einem 35jährigen Wiener namens Jonas, der eines schönen Tages (es ist der 4. Juli – Independence Day!) aufwacht und erkennen muss, dass nichts mehr ist, wie es war. Er ist das einzige lebendige Wesen in der Stadt und, wie sich herausstellen wird, auch außerhalb Österreichs, wo ihn seine Nachforschungen hinführen werden.
Die Parallelen mit Marlen Haushofers „Die Wand“ oder Herbert Rosendorfers „Großes Solo für Anton“ liegen auf der Hand und sie wurden in den diversen Besprechungen des Romans herausgearbeitet. Mit guten Gründen könnte man auch Defoes „Robinson Crusoe“ und andere Robinsonaden nennen, wo sich eine „locked in“-Situation findet. Glavinic selbst betont, dass ihm die betreffenden Bücher Haushofers und Rosendorfers nicht bekannt waren. Die Frage ist im Grunde belanglos. Liest man „Die Arbeit der Nacht“ nicht als Parabel, Todeserfahrung, Traum oder Halluzination des Protagonisten, sondern als „reales“ Geschehen – was im Sinne einer Schreckensmaximierung unbedingt zu empfehlen ist -, bringt Glavinic universelle menschliche Ängste zum Klingen.
Der Mensch auf sich allein gestellt ist ja verloren, stimmt man mit Aristoteles überein, der den Menschen bekanntlich als Zoon Politikon, als ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen, betrachtet. Unter diesem Gesichtspunkt verwundert es nicht, dass Jonas in ausgeklügelten, immer monströser werdenden Versuchsanordnungen sich selbst filmt und so ein virtuelles Gegenüber, den „Schläfer“, erzeugt. Von der Unmöglichkeit eines glücklichen Lebens in Isolation und von der Angst vom Verlassensein sprechen viele Texte der Weltliteratur, etwa das Märchen der Großmutter in Büchners „Woyzeck“. Glavinic schreibt diese Tradition auf perfide Weise fort: Dass die Welt ohne Götter ist und uns der leere Raum anhaucht, damit haben wir uns spätestens seit Nietzsche anfreunden müssen; dass die Welt nun auch ohne Menschen sei, hat Alptraumqualitäten, die bei der Lektüre den abgebrühtesten Leser nicht kalt lassen.
Den Alptraum entfaltet Glavinic auf langen 400 Seiten. Das ist ein Punkt, den man an seinem faszinierend einfachen, in konsequenter Außenperspektive erzählten Roman bekritteln könnte. In allen Einzelheiten beschreibt er Jonas‘ postkatastrophisches Leben und Handeln, Vorfall um Vorfall, Aktion um Aktion – da kann die Spannungskurve schon einmal einbrechen. Wie gegensätzlich verfährt Alois Hotschnig in „Die Kinder beruhigte das nicht“! Dieser bestellt die Saatgründe metaphysischer Ängste und Zwänge in ungleich konzentrierterer Form und in einer viel exakteren Sprache. Vermutlich sollte man die beiden Autoren aber nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie als Vertreter zweier unterschiedlicher Fraktionen sehen: jene der Liebhaber der kurzen und jene der Liebhaber der langen Form. Letztlich ist es – ähnlich wie bei der Frage nach der rechten Konfession – eine Glaubensentscheidung, wo man sich zugehörig fühlt. Jean Paul hätte sich vermutlich auf Hotschnigs Seite geschlagen, von ihm stammt der Satz: „Ich lese nichts lieber als Bücher von einigen Seiten. Sprachkürze gibt Denkweite.“
Der gebürtige Grazer Glavinic kennt Wien, wo er lebt und eine zeitlang Taxi gefahren ist, wie seine Westentasche. Auf diesem vertrauten Terrain bewegt sich der Protagonist des Romans. Die Arbeit der Nacht ist aber kein Wien-Roman, wenn man ein solches Genre ansetzen möchte. Die Stadt bleibt Kulisse und tritt nicht in ihrem spezifischen Charakter in Erscheinung. Die Beschreibung der Umwelt tritt vollkommen hinter das (Selbst-)Studium des Protagonisten zurück. Wien-kundige Leser werden mit Vergnügen die Wegmarken vor Augen haben, von denen Jonas seine SOS-Rufe in die leere Welt sendet: den Donauturm, den Prater, das Brigittenauer Hallenbad … Und sie werden Jonas‘ subtiles Vergnügen teilen, wenn er auf einem Doppelbett auf Rollen die Mariahilfer Straße hinuntersegelt und anschließend den Heldenplatz zu einem gigantischen Open-Air-Kino umfunktioniert. Wie in Schnitzlers „Leutnant Gustl“ herrscht im Roman eine genaue Orts- und Zeitregie, die die Wege des Protagonisten beglaubigt und ob dieser Realistik seine Situation noch schmerzlicher bewusst macht. Wer Wien nicht kennt, dem erklärt sich die Symbolik der Handlungsstätten nicht unbedingt. Glavinic vertraut auf das Evokationsvermögen von Namen; über den Stephansdom heißt es an einer Stelle lapidar: „Graue Mauern. Knackende alte Bänke. Statuen.“
Glavinic wurde für seinen existentialistischen Roman, der von Thema und Machart eine breite Leserschaft anspricht, 2006 der Österreichische Förderungspreis für Literatur zuerkannt. Wie professionell dieser Erfolg vermarktet wird, zeigt nicht zuletzt die vom Hanser Verlag aufgezogene schmucke Website www.die-arbeit-der-nacht.de, wo man mittels Podcast das reale Wien und das Wien aus Die Arbeit der Nacht unter Führung des Autors akustisch durchwandern kann.