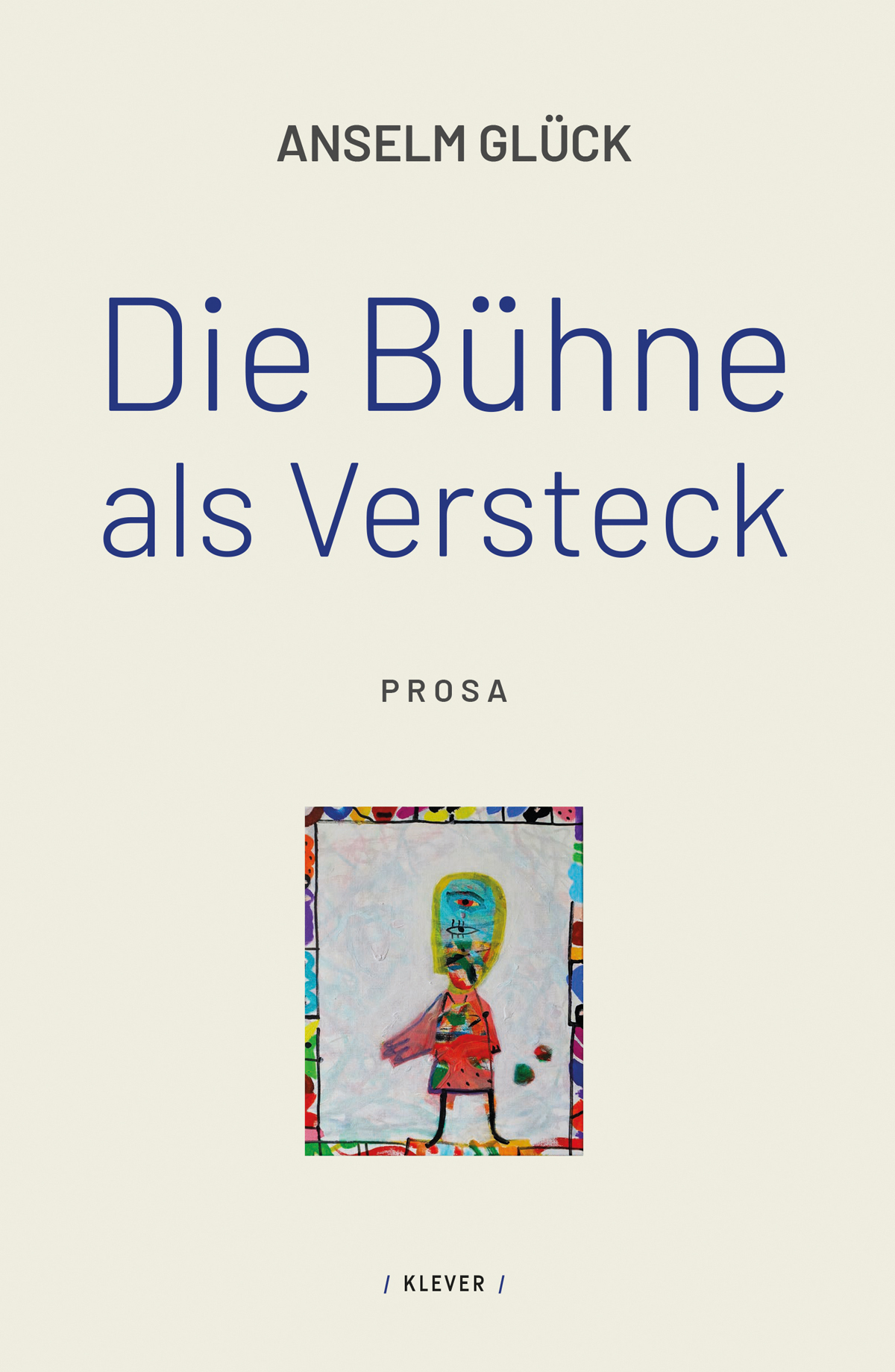Geht so etwas als mittleres Wunder durch? Wenn eine Jury, wie 2023 beim Kulturpreis des Landes Oberösterreich, Sparte Literatur, geschehen, sich noch Anselm Glücks entsinnen konnte? Schließlich lag da die letzte Buchveröffentlichung des am 28. Jänner 1950 in Linz geborenen und seit langem in Wien ansässigen Autors ein Dutzend Jahre zurück.
Der seit den frühen 1970-er Jahren literarisch aktive Glück, der 1988 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit dem Preis des Landes Kärnten ausgezeichnet wurde, debütierte 1977 in der für die österreichische Literaturavantgarde wichtigen Linzer Edition Neue Texte von Heimrad Bäcker mit dem für seine weit entfernte literarische Zukunft programmatisch werdenden Titel stumm. Seit 2012 konzentrierte sich nämlich Anselm Glück zur Gänze auf die Malerei. Im 21. Jahrhundert liegen von Glück, der 2016 mit Preisen gekürt wurde, die nach Oskar Pastior und H. C. Artmann benannt sind, zwei Theaterstücke, ein schmales Bändlein mit Prosa, zwei ebenfalls nicht lange Romane sowie, 2012 in Klagenfurt publiziert, ein Buch mit Mikroerzählungen vor.
Aus den Titeln von Glücks Veröffentlichungen ab Mitte der 1990-er Jahre ließe sich so etwas wie eine Quersumme seines Œuvres collagieren. Darin käme das lokalisierende toter winkel, blinder fleck (Droschl, 1996) ebenso vor wie das melancholische Lamento ich kann mich nur an jetzt erinnern (Droschl, 1998), die Forderung nach Mehr Gegenwart – mehr Bilder (edition splitter, 1999) und auch das Leitprinzip rastlose lethargie (edition splitter) , das 2005 die Untertitel-Folgerung auslöste, dem leben liegt es, immer wieder in gefängnisse zu entkommen.
Die Maske hinter dem Gesicht (Jung und Jung, 2007) war schließlich ein Roman-Kaleidoskop, das gedreht und geschüttelt wurde, in dem geschimpft und räsoniert wurde, in dem reale Personen auftauchten, die Schriftstellerkollegen Alfred Kolleritsch und Klaus Hoffer aus Graz etwa, jedoch in ein verfremdetes Szenario getaucht. Bilder wurden imaginiert und mit Erinnerungen gekoppelt. Die Welt war ein Gefängnis und die in Wirtshausstuben bei Bier und kleinem Gulasch verbrachte Existenz auch.
So lässt sich Die Bühne als Versteck, das aus zwei Teilen besteht, zeit- wie fugenlos neben diese Glück-Veröffentlichung stellen. Der erste Teil ist mit „Staub“ überschrieben und in 40 oft nur eine Seite umfassende Unterkapitel unterteilt. Welche Bewandtnis es mit der Verwendung der biblisch so stark geprägten Zahl 40 auf sich hat – so dauert etwa die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag 40 Tage, bei der Sintflut regnete es 40 Tage und 40 Nächte und ebendiese Zeit verbrachten Noah und die Tiere an Bord der Arche, Moses harrte auf dem Berge Sinai 40 Tage aus, bevor er mit den Gebotstafeln herabstieg –, dürfte wohl bald ein Thema für germanistische Untersuchungen werden. In „Staub“ sitzt der namenlose Ich-Protagonist in einer Zelle und rebelliert gegen Mauern, die er permanent mit sich herumträgt.
Von nicht allzu fern winken Franz Kafka und Dino Buzzati (1906-1972) herüber. Letzterer schuf mit Il deserto dei Tartari (1940, dt. Die Tatarenwüste) eine Langerzählung, die von einer Unheil versprechenden Isoliertheit in einem Nirgendwo handelt. Der Dritte im Einfluss-Bunde dürfte Samuel Beckett sein. Denn auch Humor findet sich bei Glück, wenn auch oft à la Beckett dunkel grundiert. Die einzelnen Texte sind miteinander verkettet, beginnen sie doch mit „Und“, „Aber“, „Wenn“ oder mit „Oder“.
Der zweite Teil, der dem Band den Titel gibt, ist dann etwas Anderes, und zugleich ein Spiegel davon. Es ist ein Spiel mit Zitaten in 185 knappen Einträgen. Glück nimmt Formulierungen und Bilder von Rilke wie aus Sachbüchern und überführt sie in einer Montage in neue sprachliche Kontexte, versteckt sie also auf offener Bühne. Etwa dies, die Nummer 3, deren Wörter, wie Glück angibt, Otto H. Resslers Abhandlung Soshana. Weltensammlerin (2016) entnommen sind und sinnig für die folgende Notate stehen können: „Erzeugte Bilder mit eingebautem Betrachter, dessen Aufmerksamkeit nachempfunden wird von einem unverwechselbaren Selbst, das nicht abzuhalten ist und ohne Pause zur Verfügung steht“ (S. 65).
Da ergibt sich Harmonie, gelegentlich auch pathetischer Zwieklang. Nicht selten nähern sich die Einträge aphoristischer Zuspitzung: „Er zog sich das Gesicht zurecht, blätterte um und begann zu hören, was am Nebentisch gesprochen wurde. Er hatte dabei den Eindruck, in den anderen festzustecken und, sachlich eingefroren, fremden Träumen nachzuhängen“ (S. 65).
Diese Miniaturen korrespondieren subtil miteinander, gelegentlich, sie spiegeln sich fragmentarisch, hie und da. Wie hieß es gleich noch mal in Anselm Glücks Die Maske hinter dem Gesicht: „Alles widerspricht von Zeit zu Zeit allem und sich selbst. Aber manchmal fügt sich auch manches, und neue Böden werden gewonnen und neue Horizontschluchten tun sich auf. Beziehungs- und Bedeutungszickzack. Bei wechselnder Beleuchtung. Unruhige Muster, von tiefen Schatten durchsetzt. Schwank und, wenn man will, voller Verheißung.“
Alexander Kluy ist Autor, Kritiker, Herausgeber, Literaturvermittler. Zahlreiche Veröffentlichungen in österreichischen, deutschen und Schweizer Zeitungen und Zeitschriften. Editionen, zuletzt Konrad Engelbert Oelsner Luzifer oder Gereinigte Beiträge zur Französischen Revolution (Limbus, 2024) und Felix Dörmann Jazz (Edition Atelier, 2023). Zahlreiche Buchveröffentlichungen, zuletzt in der Edition Atelier die Bände Das Kreuzworträtsel und seine Geschichte (2024), Der Regenschirm. Eine Kulturgeschichte (2023) und Giraffen. Eine Kulturgeschichte (2022) sowie im Corso Verlag Vom Klang der Donau (2022).