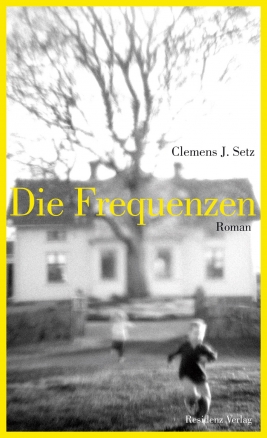Im Zentrum der Frequenzen stehen zwei junge Männer, Alexander Kerfuchs und Walter Zmal. Die beiden, deren Väter einmal befreundet waren, kennen sich seit Kindertagen, haben einander im Lauf der Jahre jedoch aus den Augen verloren. Alexanders Vater ist nach einem Treffen mit der Familie Zmal urplötzlich verschwunden – so dass der Junge allein mit seiner Mutter aufgewachsen ist. Alexander ist Altenpfleger geworden und steckt gerade in heftigen Liebeswirren. Walter wiederum ist vor allem der Sohn eines berühmten Architekten. Seine Eltern wünschen sich heftig einen künstlerischen Beruf für ihn. Kürzlich hat er seine Bisexualität entdeckt und fühlt sich zum Schauspieler berufen. Alexander und Walter werden einander wieder begegnen und doch einzelne bleiben – wie alle Protagonisten in diesem Buch der Vereinsamten, Verrückten oder sonst irgendwie Versehrten. Denn jeder sendet hier nur auf seiner eigenen Frequenz und die Lektüre ist ein bisschen wie das Drehen an einer Radioskala: mit jedem Kapitel kommt eine andere Stimme zu Wort.
Die Verbindungen zwischen den Kapiteln entstehen vor allem dadurch, dass die Personen sich direkt oder über Dritte kennen. Zum Beispiel spielt Walter den (bezahlten) agent provocateur in der Therapiegruppe von Valerie, der neuen Flamme von Alexander. In dieser Gruppe ist auch Gabi, die durchgeknallte junge Mutter mit dem Tinnitus, die sich in Walter verliebt. Dann gibt es noch Steiner, den psychotischen Vermieter von Alexander. Und Lydia, die Langzeit-Freundin von Alexander, die nun Valerie weichen soll. Doch Valerie, so stellt sich heraus, ist auf der Straße zusammengeschlagen worden und stirbt, ohne vorher aus dem Koma erwacht zu sein. Ein anderer Verschwundener taucht hingegen wieder auf: Alexanders Vater, der gerade dabei ist, sich wieder zu verheiraten. Statt dem Sohn tritt also der Vater vor den Traualtar – eine Pointe des Patchworkzeitalters, das die Regeln des geordneten Übergangs von der family of generation zur family of procreation auf den Kopf stellt.
In diesem Roman findet kein geordneter Aufbau einer konsistenten Geschichte statt. Im Horizont klassischer Romanpoetiken könnte dies natürlich als negativer Befund verstanden werden. Doch Clemens J. Setz ist ein sehr bewusster Erzähler. Sein Roman funktioniert nach einem Prinzip, das er selbst einmal beschreibt – dem der Rube-Goldberg-Maschine. Der Mechanismus dieser Maschine setzt auf ausgeklügelte Weise eine Kettenreaktion in Gang, die mit viel Aufwand bei großem Unterhaltungswert zu einem vergleichsweise mageren Ergebnis führt. Ökonomisches Erzählen ist das nicht, nein. Aber dies Buch soll laut Setz‘ eigener Aussage vor allem Spielqualitäten besitzen, die das Bewusstsein der Leser animieren und reizen. „Die Qualität oder der Charme eines Kunstwerks zeigt sich mitunter darin, ob es sich in unserer Erinnerung selbstständig verwandelt. Wie viele Leute erinnern sich beispielsweise an einen Tropfen, der aus einer zerfließenden Uhr von Dalí quillt, ohne dass ein solcher Tropfen auf dem Bild tatsächlich zu sehen wäre. (…) Oft geht das Gedächtnis einen Schritt weiter als die Kunst. Es gibt keine Schlange um Laokoons Hals.“
Clemens J. Setz‘ Buch ist auf vertrackt-intelligente Weise in das Scheitern verliebt. Seine Texte sind wohltuend weit entfernt von allen Vorstellungen eines kleinen Glücks, von irgendwie wohl geordneten Verhältnissen. Seine Figuren zeigt er ausschließlich von ihrer weltabgewandten Seite. Denn alle sind ständig mit sich selbst beschäftigt. Die Flimmerhärchen ihres Bewusstseins tasten die Umgebung auf Reize ab und bestaunen die eigene Wahrnehmung. Da ist Krankheit eine vergleichsweise wohlige Möglichkeit, sich den Zudringlichkeiten der Außenwelt zu entziehen. Walter denkt: „… es war ein warmer Tag und ein wenig gefiel ihm die Vorstellung, sich eine Erkältung einzufangen, nichts Schlimmes, nur ein kleiner Dämpfer, der ihn für die nächste Zeit von allen Verpflichtungen und Anfeindungen befreite.“ So bewegungsunfähig die Menschen erscheinen, so dynamisch und lebendig sind dagegen die Dinge. Da gibt es rennende Parkbänke, sich räuspernde Schneeschaufeln und sprechende Hunde. Auch wenn Setz gerade hier zuviel des Guten tut, originell ist es doch, über klemmende Schubladen zu schreiben: „Sie blieben verschlossen wie der Mund eines Kindes, vor dem ein Löffel mit Lebertran schwebt.“
So wie sich seine Figuren eher auflösen als konstituieren, ist auch dieser seitenstarke Roman ständig dabei, zu dissoziieren, zu zerbröseln. Leider erlahmt das Interesse an den vielen feinen Beobachtungen und essayistischen Betrachtungen in der zweiten Hälfte des Romans stark. Manches wirkt dann eher wie ein Sammelsurium von Textteilen, eine Addition beliebiger Details. Die Frequenzen sind das nicht ganz gelungene Buch eines äußerst viel versprechenden jungen Autors. Denn Clemens J. Setz ist genau das, was im Feuilleton gern einmal behauptet wird, was aber tatsächlich eher selten ist: eine neue Stimme mit einem ganz eigenen Ton.