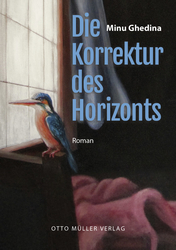Ada, die Protagonistin des Romans, wächst bei ihrer Großmutter, einer Schneiderin, auf. Die Mutter sieht sie nur selten und wenn, bleibt diese distanziert zu ihrer Tochter. Desinteresse der alkoholkranken Mutter ist das entscheidende Merkmal dieser Beziehung. Ein Verhältnis, das sich bis zu deren Tod nicht ändert.
Auch der Vater, von dem Ada erst spät erfährt, dass er nicht ihr Erzeuger ist, zeigt keinerlei Wärme für sie. Im Gegenteil, die Eltern leben mit der jüngeren Schwester ein vermeintliches Idealbild einer Kleinfamilie, in der Ada nur ein störender Gast ist. In der Öffentlichkeit wird sie sogar verleugnet.
Trotz der liebenden Fürsorge der Großmutter fühlt sich Ada immer ausgestoßen, nicht geliebt. Es ist die klassische Familie, die sie für sich ersehnt: Vater, Mutter, Kind. Wie sie es bei Freunden erlebt. Selbst wenn es in anderen Familien Brüche gibt, wird Ada bis zum Ende des Romans von diesem bürgerlichen Ideal als eigentliches Lebensziel nicht abweichen und nie lernen, Freundschaften und Wahlverwandtschaften einen ebenso hohen Wert wie Blutsbanden zu geben.
Dabei könnte man Adas Lebensgeschichte von außen betrachtet als eine Erfolgsgeschichte sehen. Eine Oma, die sich für sie einsetzt und gegen Angriffe der Eltern verteidigt. Erfolg im Studium und in der Karriere als Kostümbildnerin am Theater und beim Film.
Sicher, gerade die Theaterwelt kann man als Bild für eine Flucht vor der Realität lesen. Zumal es Ada bei ihren Entwürfen nie um Provokationen, sondern ausschließlich um Schönheit geht. Statt Kontroverse strebt sie, wie in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Kunst eine seltsam aus der Zeit gefallene Idylle an und offenbart ein extrem konservatives Geschlechterbild.
Dieses setzt sich natürlich in ihrem Verhältnis zu Männern fort. Ihre Unsicherheiten führen sie in eine toxische Beziehung. Ada ist zudem eine Meisterin der Kommunikationsverweigerung. Sie zieht sich zurück, ohne sich zu erklären und erwartet von ihren Partnern stets hundert Prozent Verständnis. Und sie weint viel und aus allen möglichen Anlässen – das äußere Zeichen ihrer psychischen Verfassung.
Ada hat ein Idealbild von zwischenmenschlichen Beziehungen, aber nie gelernt, dass man auch miteinander reden und Kompromisse eingehen muss. Sie erwartet von Männern, die Rolle des Beschützers zu erfüllen, der für ihr Wohlbefinden sorgen soll. Ihr egozentrisches Handeln fällt ihr dabei nicht auf.
Zudem tut sie sich ein Leben lang mit allem Körperlichen schwer. Der Blick auf den Horizont, der Blick auf Farben fällt ihr leicht. Aber alles Haptische, eine Umarmung oder Berührung befremdet sie. In der Pubertät beobachtet sie, wie die Mitschülerinnen mit ihrem Körper spielen und was das bei den Jungen bewirkt. Ihr eigener sich verändernder Körper bleibt ihr fremd. Selbst als Erwachsene findet sie die Geräusche der Nachbarn beim Beischlaf verstörend.
Sogar bei den Stoffen, mit denen sie arbeitet und von deren Farben sie ausführlich schwärmt, fällt kaum ein Wort zur Beschaffenheit des Materials. Ob er weich oder hart, sanft oder rau ist. Ada verspürt diesen Makel, aber sie kann ihn nicht ausgleichen.
Erfolge haben für sie selbst eine geringe Bedeutung im Vergleich zu ihrem Wunsch, wenn schon nicht von der Mutter, so doch vom fernen und lange unbekanntem Erzeuger anerkannt zu werden. Sein eindeutiges Nein zu jedem Kontakt mit ihr, so brutal dies ist, kann sie nicht akzeptieren. Der Halbschwester, die nichts von ihrer Existenz wusste, verzeiht sie die ablehnende, schockierte Reaktion auf ihre überraschende Begegnung nicht.
Ada gelingt es zum Ende der Geschichte, ihren Traum von einer Kleinfamilie zu realisieren. Natürlich macht auch hier das reale Leben einen Strich durch die Rechnung. Für Ada ist das endlich die Chance, ihre eigenen Stärken wertzuschätzen und sich aus dem Korsett der Verletzungen und Wünsche zu befreien. Sie kann nun selbst die Linie des Horizonts bestimmen und den Lesern bleibt es belassen, zu überlegen, ob sie dies schaffen oder doch in alte Verhaltensmuster zurückfallen wird.
Minu Ghedina schiebt immer wieder Zeilen mit Metaphern ein, die die Fremdheit von Ada in der Welt deutlich machen. Es sind Bilder, die manchmal an eine psychische Störung erinnern und stark von Farben geprägt sind. Sie beschreibt oft den verschwommenen Blick aus dem Fenster, zwischen ihr und der Welt eine trennende Scheibe. Die Krise als Dauerzustand wird hier besonders deutlich.
Das eigenwillige Weglassen von einigen Satzzeichen, die oft überbordenden Metaphern, das Abgleiten in anscheinend belanglose Beobachtungen (etwa bei der Beschreibung einer U-Bahnfahrt zu ihrem Liebhaber), all das entpuppt sich als Mittel, um die Unsicherheit, das Fremdsein in der Welt bildlich umzusetzen.
Die Korrektur des Horizonts ist kein Entwicklungsroman im klassischen Sinn. Denn dazu fehlt die Emanzipation der Hauptperson von ihren tiefen seelischen Verletzungen und von ihrem familiären Wunschbild. Aber Minu Ghedina gelingt es aufzuzeigen, wie sehr Verletzungen in der Kindheit das ganze Leben prägen.
Denn was nützen Erfolge, wenn man die Ablehnung der Eltern nie überwinden kann?
Minu Ghedina hat einen lesenswerten Roman geschrieben, der in Zeiten, in denen viel über neue Familienkonstellationen diskutiert wird, aufzeigt, wie sehr sich viele Menschen nach der Geborgenheit der Eltern, nach einem stabilen Horizont für ihr Leben sehnen.