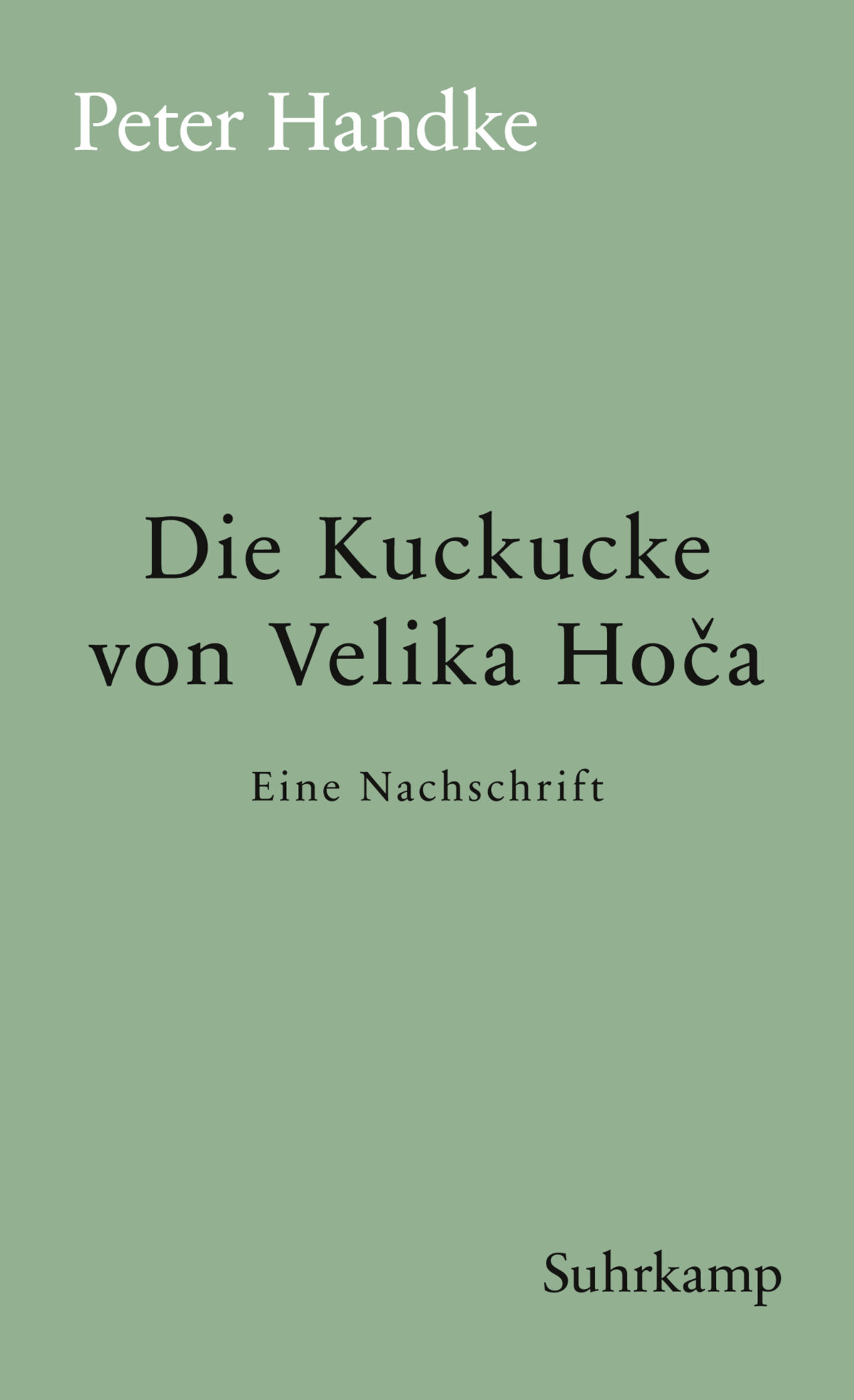Rambouillet, so nennen die Bewohner der serbischen Kosovo-Enklave Velika Hoča einen fensterlosen Container, der mit dem Pfarrhaus das zweite Zentrum des kleinen Ortes bildet. Alte Männer, die Dorfältesten, sitzen drinnen zusammen und reden. „Sich zu ihnen setzen zu dürfen, spielte der Wortführer das Spiel dann weiter, das war ein Privileg.“ Peter Handke kam dieses Privileg zu, vielleicht auch, weil er das Preisgeld für den alternativen Heine-Preis, immerhin 50.000 Euro, dem Dorf gespendet hatte – das aber lässt er in seinem neuen Buch Die Kuckucke von Velika Hoča unerwähnt.
Im Mai 2008 war Peter Handke in das Kosovo aufgebrochen, um die serbische Enklave Velika Hoča zu besuchen. Begleitet wird er von Zlatko B., „dem berühmten Lebenskünstler (= Nichtstuer, und gelegentlich Weinbauer, und noch gelegentlicher Maler)“ und Ranko, einem jungen serbischen Dichter aus dem Südkosovo.
„Das Vorhaben, anders als all die Male zuvor, bestand bei diesem Besuch freilich nicht nur aus dem bloßen Dabeisein, Mitfeiern, Anschauen und Zuhören. Es drängte mich, den und jenen einzelnen im serbischen Kosovo ausführlich, sozusagen systematisch, in der Rolle eines Reporters oder meinetwegen Journalisten, zu befragen, und die Antworten dem entsprechend mitzuschreiben.“ Kein Wunder aber, dass dieser Vorsatz bei einem wie Handke nicht gelingen kann – und das ist auch gut so.
Wie immer geht es Handke nicht um die eine Wahrheit, sondern um die Wahrheit jedes Einzelnen. Er erzählt vom Popen Milenko, der während der Luftangriffe wahnsinnig gewesen sei. Eine Bäurin, befragt nach der Lage, sagt: „Es ist ruhig.“ Und lässt Sätze folgen wie „Wir sind immer noch im Krieg.“ Handke kauft sich eine Karte, die „Ethnic Albania“ zeigt, das weit über die Grenzen Albaniens und des Kosovo hinausreicht. Nie hört er in seinen Gesprächen das Wort „Recht“, oft aber „Unrecht“. Das rein albanische Nachbardorf ist ein ehemaliges geworden: „Bis zu meinem Tod werde ich keinen Fuß mehr dorthin setzen.“, sagen die Bewohner von Velika Hoča.
Das sind einzelne Befunde, denen man andere entgegensetzen könnte. Man könnte gegen- und aufrechnen. Man könnte Handke vorwerfen, dass er nur eine Seite zeigt, die der serbischen Minderheit, die Albaner aber in seinen Aufzeichnungen praktisch nicht vorkommen. Man kann es kritisieren. Muss man aber? Seine Blicke, und es sind wie immer sehr feinsinnige, gelten den Schwachen, den Übriggebliebenen, den „Hinterzimmerbewohnern“ – und das sind im Kosovo eben die Serben. Handke hat in seinem Schreiben immer den subjektiven Zugang gewählt. Das macht ihn angreifbar, nämlich kritisierbar, aber eben auch greifbar. Und damit werden sich Kritiker wie Verehrer auch in diesem Buch in ihren (Vor)Urteilen bestätigt finden.
Am schönsten ist wohl das Schlusskapitel, die „Nachschrift der Nachschrift“, die dem Bedeutungs- und Deutungslosen gilt: „Und jener letzte oder vorletzte oder erste Morgen in Velika Hoča, da ich, aus meinem Quartier durch das Hoftor auf den Dorfplatz getreten, mich auf die Stufen vor dem Tor setzte, da der eine kleine Streunhund sich zu mir gesellte, da die Enklaven-Kinder über den Platz zur Schule gingen, da die Enklaven-Alten sich aufmachten zu ihren hoffnungslos-heiteren Tagesrunden, da die Dorfplatzlinden grünten, und da unter uns allen ein illusionäres Einverständnis herrschte, nicht mit der Geschichte, bewahre, aber mit der Morgenluft, der Ratlosigkeit, dem Rundenziehen, dem Dasitzen.“
Anders als in manchen früheren Jugoslawien-Texten wirft Handke in den Kuckucken von Velika Hoča dem Westen keinen Fehdehandschuh vor die Füße und zeigt, wie auch schon in „Die morawische Nacht“ eine gewisse Altermilde. Sie steht ihm äußerst gut.