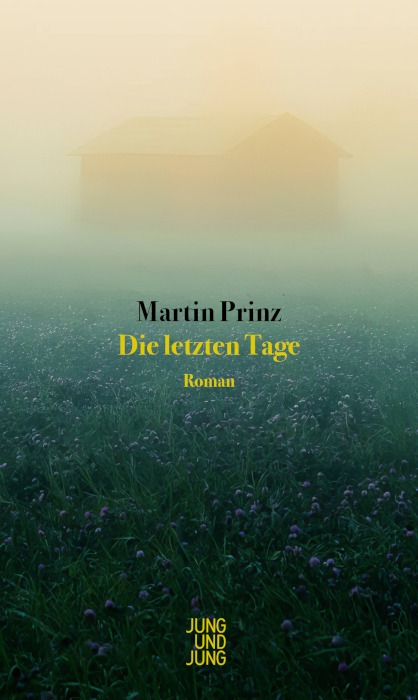Die Sinnlosigkeit und Absurdität des Blutrauschs der „letzten Tage“ des Zweiten Weltkriegs an der kleinen Talöffnung in den Ostalpen zeigt sich auch daran, dass die Rote Armee nur wenige Kilometer entfernt steht und bloß noch darauf wartet, dass die Schlacht um Wien entschieden wird. Kreisleiter Braun wird später aussagen, er habe „alle Widerstände, die einen unglücklichen Verlauf des Krieges herbeiführen könnten“, beseitigen und Kampfdisziplin und Moral aufrechterhalten wollen (S. 33).
„Sie gehören umgelegt“, war der 27-jährige HJ-Führer Wallner überzeugt. „Und die anderen draußen bekommen wir auch noch!“ (S. 95) Mordrausch als Illusion der Macht in einer Zeit des Kontrollverlusts, während der Rest des Orts schwieg, um nicht selbst zu dessen Opfer zu werden – eine Tragödie, bei der die als politisch unzuverlässig qualifizierten Männer, Frauen und sogar Minderjährigen erschossen und dann teilweise sogar noch öffentlich aufgehängt wurden. Dabei standen junge Helfer und aßen lachend Marmeladebrote.
Wie so oft unter dem verbrecherischen und überbürokratisierten NS-Regime existieren umfangreiche Dokumente über das Geschehen, teils öffentlicher, teils privater Natur. Die letzten Tage beruht in größeren Teilen auf den Recherchen von Alois Kermer, eines Beamten der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, die dieser im Jahr 1993 begonnen hatte. „Kermer sichtete fortan Akten und Protokolle, er forschte nach Lebensdaten, Zeitzeugen, befragte Überlebende und Nachkommen der Toten, glich Dokumente und Aussagen ab, stellte Chronologien und Zusammenhänge her, überprüfte Befehlsketten und ordnete Verantwortlichkeiten“, schreibt Prinz in seiner so knappen wie aufschlussreichen Nachbemerkung (S. 258).
Als Kermer 89-jährig in Jahr 2002 seine Ergebnisse der Gemeinde Reichenau übergab, teilte diese ihm mit, dass eine Veröffentlichung doch nicht möglich sei. Glücklicherweise sicherte der Standesamtsleiter Hermann Scherzer eine Kopie davon. 2006 verstarb Kermer, im Jahr 2014 überreichte Scherzer Martin Prinz das gerettete Konvolut, aber diesem erschien es als anmaßend, Scherzers Wunsch nachzukommen, „etwas daraus zu machen“ (S. 259). Scherzer gab die Recherche, „sorgsam ediert“, 2016 schließlich als Sachbuch heraus (S. 259). Aber der Stoff ließ Martin Prinz dennoch nicht los.
Die letzten Tage gehen über die Informationen, die Kermer zusammengetragen hatte, jedoch hinaus, denn Prinz stieß auf weiteres Material, etwa einen Überblicksbericht über den Volksgerichtsprozess von 1947, 2008 von dem Publizisten Martin Zellhofer veröffentlicht.
„Keine berühmten Nazis reden hier“, schreibt Prinz in seiner Nachbemerkung, „keine der berüchtigten Namen. Zuerst bleiben sie lapidar, dann versuchen sie es harmlos, sprechen, als würden sie damit Normales beschreiben, dann schieben sie Verantwortung ab, die Größeren auf die Kleineren, die Kleineren auf die noch Kleineren und immer weiter, während durch alle Ränge abwärts nur zu deutlich wird, dass jeder die eigenen Taten auf andere schieben muss, weil sie alle abseits der Befehlsketten das Böse nicht nur zuließen, den Mord, die Denunziation, die Massakrierung, sondern jede Gelegenheit aus eigenem Antrieb nutzten.“ Prinz fand nur einen ehrlichen Zeitzeugen, Heinrich Spielbichler, der 1945 ein Gedächtnisprotokoll verfasst und darin auch jene Momente festgehalten hatte, „in denen er gehorchte, um nicht selbst auf der Stelle umgebracht zu werden“. (S. 260f.)
Prinz’ eigener Beitrag zum Thema, den er nun, zehn Jahre später, vorlegt, heißt Roman und liest sich beinahe wie ein Sachbuch. Denn Prinz entschied sich dazu, den Stoff nicht im klassischen Sinne zu fiktionalisieren, mit erfundenen Dialogen und der Evokation von Atmosphäre, dem Eintauchen in die Gefühlswelt seiner Personage, der Deskription des politischen Hintergrunds. Er lässt die Texte, die diese düstere Zeit dokumentieren, für sich sprechen, indem er sie auswählt und montiert.
Dabei interessiert Prinz sich wie Arno Frank in seinem aktuellen Roman Ginsterburg (Klett Cotta, 2025) für die Sprache der Täter, allerdings nicht, indem er sie sich wie dieser aneignet, sondern indem er sie in indirekter Rede wiedergibt. „Es ist ein Sprechen“, schreibt Prinz in der Nachbemerkung, die man unbedingt an den Beginn der Lektüre setzen sollte, „das sich hämisch gegen andere richtet, die eigene Täterschaft bestenfalls erstaunt mit übergeordneter Notwendigkeit eingesteht, derart verdreht, als könnten gerade sie als Täter doch nichts anderes als Opfer sein. Es ist diese Sprache, die beim Wort genommen werden muss, die hörbar gemacht werden muss, damit sie in ihrer passiven Leideform nicht wieder zum Hinterhalt wird.“ (S. 261)
Diese „passive Leideform“ passt zu der Tatsache, dass die Täter sich selbst als Opfer sehen. Konkret bedeutet sie, dass der Roman durchgehend im Konjunktiv geschrieben ist. „Er habe (…) “, „Es sei (…)“, „Du hättest (…)“, beginnen seine Sätze, die erdrückend manieriert wirken und damit die Unnatürlichkeit und Grausamkeit der Vorgänge gut abzubilden vermögen. Eine angenehme Lektüre ergibt sich daraus naturgemäß nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass das Geschehen nicht chronologisch präsentiert wird.
Die vergangene Realität aus den Protokollen und Erinnerungen zu rekonstruieren, macht die Lektüre zu einer regelrechten Schwerarbeit, die dem Thema angemessen scheint und in der man vielleicht so etwas wie Buße sehen könnte. Einzig die Kürze der einzelnen Abschnitte von ein bis zwei Seiten schafft Erleichterung. Die drei Rädelsführer Braun, Wallner und Weninger wurden übrigens 1947 zum Tode verurteilt – ob man darin so etwas wie Gerechtigkeit sehen will, bleibt einem selbst überlassen.
In Frage stellen könnte man, dass der Roman sich zu stark auf die Täter konzentriert. Er sei ein Opfer des Krieges geworden, sagte Kreisleiter Braun nach dem Krieg vor dem Volksgerichtssenat über den Tod des minderjährigen Roman Kneissl als Antwort auf die Frage, „ob es ihn in stillen Stunden nicht bedrücke, ein Kind zum Tod verurteilt zu haben. Ein Opfer des Krieges. So wie er sich selbst auch sehe.“ (S. 12) Der Täter als Opfer – eine nie enden wollende Rechtfertigung vonseiten Schuldiger. Wer solchen unwürdigen Geistern literarisch Raum gibt, hält implizit an der Annahme fest, daraus etwas lernen zu können. Wenn nicht aus der Geschichte, so doch jedenfalls über das Wesen des Menschen. Eine aufbauende Lektion ist das nicht.
Die Opfer werden vom Autor in kurzen, poetisch angehauchten Abschnitten zwar immer wieder als ein „Du“ angesprochen – auf diese Weise zollt Prinz ihren Leiden Reverenz, aber die Täter bleiben sein Zentrum. Der Roman endet mit dem Satz: „Jahrzehnte später wollte davon niemand mehr etwas wissen.“ (S. 256) Verdienstvollerweise hat Martin Prinz mit Die letzten Tage dieser reflexhaften Reaktion ein Ende gesetzt und damit ein düsteres Kapitel heimischer Geschichte zugänglich gemacht.