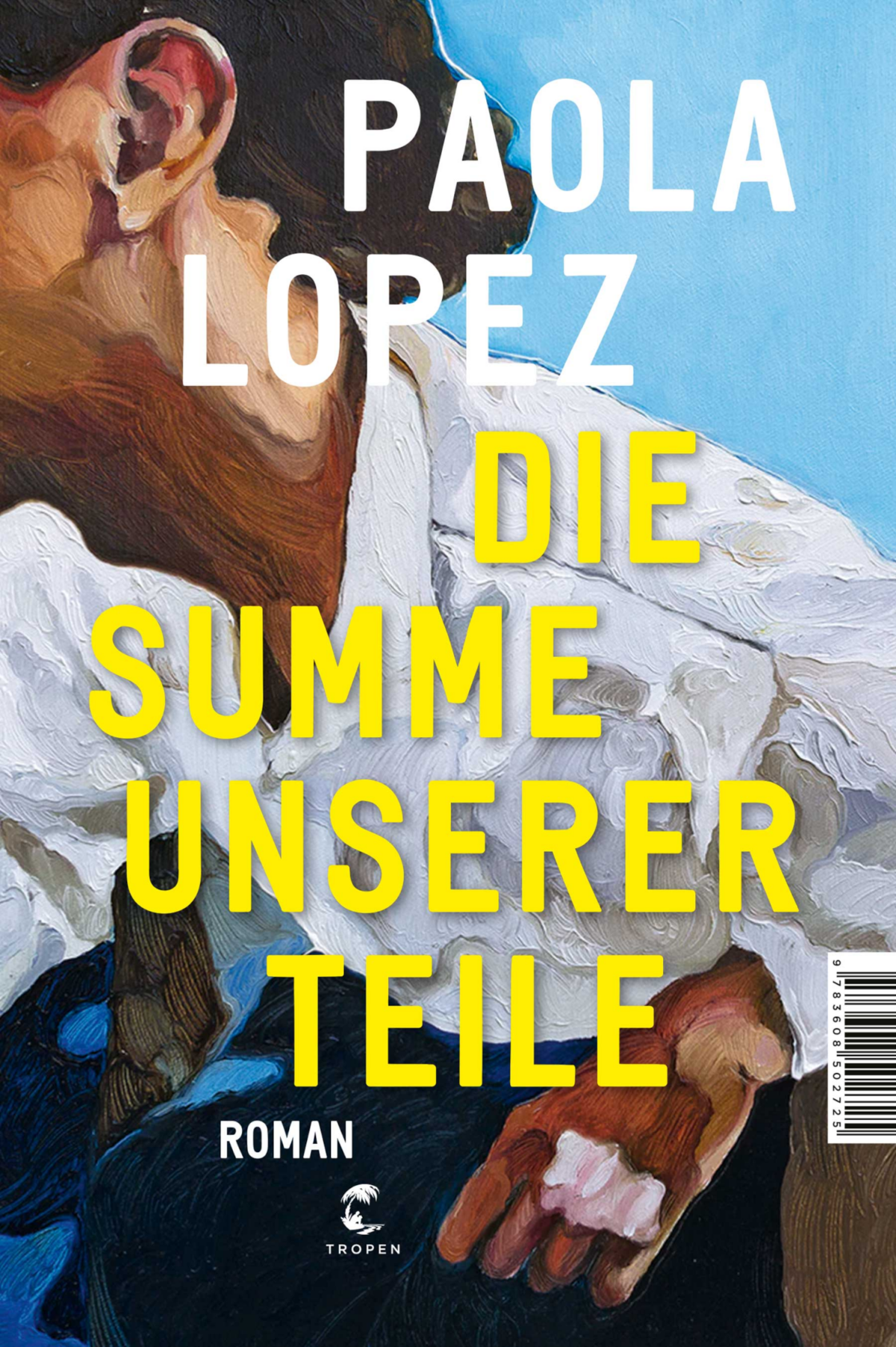Drei Generationen Frauen
Lucy ist die jüngste der drei Frauen in Die Summe unserer Teile, sie ist die Tochter. Sie lebt in Berlin mit ihren besten Freunden Phil und Oliver, „ihrer Wahlfamilie“ (S. 71). Ihre Mutter, Daria Krawczyk, mit der sich Lucy überworfen hat, schickt ihr eines Tages einen Steinway-Flügel in die WG, der so groß und überdimensional ist wie die Gefühle zwischen Mutter und Tochter selbst. Es ist ein starkes Symbol einer innigen Beziehung, die dennoch nicht funktioniert, weil Lucy ihrer Mutter Vorwürfe macht: Sie habe ihr Zeit ihres Lebens ihre polnische Großmutter, Lyudmila, vorenthalten, dabei hätte sie ein Recht auf sie gehabt. Lucy weiß fast nichts über sie, außer dass sie während des Ersten Weltkriegs in den Libanon auswanderte, und auch die Beweggründe ihrer Mutter Daria werden erst im Laufe des Romans entschlüsselt, als Lucy sich auf eine Spurensuche nach Polen begibt.
Die Autorin schildert in mehreren Zeitebenen die traumatischen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass sich die drei Frauengenerationen nie wirklich gemeinsam auf Augenhöhe begegnet sind; bis auf eine kurze Phase in Lucys Kindheit, an die sie sich aber nur noch schwer erinnern kann. In der Sprache der Mathematik ließe sich diese Geschichte wohl zu einer handlichen Gleichung verdichten, wie die Autorin in einem vom Verlag zur Verfügung gestellten Interview ausführt: „Diese ganzen, zugegeben manchmal gruselig aussehenden Formelausdrücke (…) sind eigentlich nur Abkürzungen für Sätze, Aussagen und Wörter.“ Aber nicht nur in der Mathematik, sondern auch beim Schreiben brauche man eine große Geduld und sehr viel Frustrationstoleranz, wie Paola Lopez ergänzt.
„Choreografie des Schweigens“
Die Initialzündung zu ihrem ersten Roman sei das geflügelte Wort „Every family is a failed utopia“ des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Lethem gewesen, erklärt die Autorin im Interview weiter und beschreibt damit auch die Zusammenhänge zwischen den drei Frauengenerationen, die sie in einer knappen, präzisen Sprache mit vielen Dialogen erzählt. Daria, die Mutter von Lucy, war für ihre Mutter, Lyudmiła, eine Bürde, oder zumindest empfand sie es so. Als Daria selbst Mutter wird, will sie eine bessere Mutter sein, eine Mutter, die ihr Kind vor ihren Beruf stellt und nicht umgekehrt. „Ich werde ihr nie das Gefühl geben, dass sie unerwünscht ist.“ (S. 92)
Da sich Daria auf ihren Mann Robert, der Psychiater ist, verlassen kann, ist sie nicht auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen – und so kommt es zum Bruch mit ihr. Doch auch zwischen ihrer Tochter Lucy und ihr kommt es schlussendlich zu einem Zerwürfnis, das jahrelanges Schweigen nach sich zieht. „In jeder Generation ein Bruch in der Sprache. An den Bruchkanten: Schweigen.“ (S. 99), denkt sich Lucy, als sie auf ihrer Reise nach Polen den Zugschaffner Władek kennenlernt. Durch die Begegnung mit ihm wird es ihr möglich, das Land ihrer Großmutter und seine Kultur besser zu begreifen. Und auch die „Choreografie des Schweigens“ (S. 186) innerhalb ihrer Familiengeschichte wird schließlich durchbrochen, als ihre Mutter sie anruft und ihr sogar nach Polen nachreist.
„Konflikt, Argument, Gegenargument, Gegengegenargument, Klärung, Erleichterung. Manche Dinge lassen sich nicht durch Reden in Einzelteile zerlegen, betrachten und schlussendlich lösen.“ (S.134) An die Erzählung, dass man immer über alles „reden, reden, reden“ müsse und dass sich alles klären lasse, will Lucy bald nicht mehr glauben. So wie ihre Großmutter damals in den Libanon floh, um sich der britischen Armee anzuschließen, war Lucy nach Polen geflohen. Aber ihre Mutter folgt ihr. Sie sucht das Gespräch, vor dem Lucy flieht. In Sopot, dem kleinen polnischen Ort, erwartet ihre Mutter sie im Grand Hotel beim Pier. Ob sie hier die „umfassende Grammatik der Familie“ (S.199) geliefert bekommt? Sie weiß jetzt schon, dass dies der Moment ist, der alles in ein Vorher und ein Nachher teilt.
Lucy ergänzt nach und nach die „unvollständige Grammatik der eigenen Familie“ (S. 199), bis das Ganze mehr als „die Summe seiner Teile“ ergibt. „Immer war ihre Mutter so unnahbar. Sie hat das Unvorstellbare getan, sie hat Lucy einen Teil ihrer Familie weggenommen“ (S. 228), denkt Lucy. Auch als sie schließlich erfährt, warum Daria ihr ihre Mutter Lyudmiła, die Großmutter, vorenthalten hat, kann sie ihr trotzdem (vorerst) nicht vergeben. Dafür entdeckt sie einen „überraschende[n] Aspekt des Kinderkriegens, die Disziplinierung der Mütter“ (S. 116).
Paola Lopez zeigt in eindringlichen Bildern, die auch die Fauna und Flora der polnischen Ostsee beschreiben, wie zersetzend und zerstörend sich das Schweigen zwischen den Generationen auswirken kann und wie sehr Sprache und Herkunft familiäre Beziehungen prägen – ein Thema, das sie auch aus eigener Erfahrung kennt. Sie hat selbst auch eine polnische Großmutter mütterlicherseits, ihre Mutter wiederum ist im Libanon aufgewachsen, ihr Vater in Mexiko und sie selbst in Wien, lebt aber in Berlin. Nirgends, so Lopez, hätte sie so große Unterschiede in den Umgangsformen erlebt wie zwischen Österreich und Deutschland: hier viele höfliche Konjunktive, dort direkte Ansagen ohne Floskeln.
Juergen Weber arbeitete an den Universitäten Wien, Prag, Berlin und Boston, derzeit an einer italienischen Universität und als freier Autor für verschiedene Literaturportale, u. a. www.rezensionen.ch