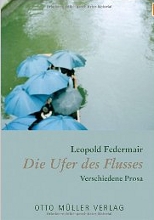Federmair zieht dabei das Beschreiben dem Erzählen eines Geschehens vor. Entstanden sind daher Texte, die Elemente von Porträts, Skizzen, Landschaftsbeschreibungen, Reflexionen miteinander kombinieren. Federmair beschreibt die Ankunft eines Messerschleifers, Menschen in einem Vorortzug, ein Wettcafé, zwei Verliebte: „In einer Vollmondnacht sah ich ein küssendes Paar, die einsgewordenen Schatten auf einer Bank am Flußufer. Als ich näherkam, zog sich der Schatten des Mädchens aus dem des Jungen zurück.“
Explizites Benennen ist nicht Federmairs Ding, kaum einmal nennt er Orte, kaum einmal Namen, nie Zeitpunkte. Die Textrahmen bleiben abstrakt. Natürlich erkennt man in den Texten Orte wieder, an denen der Autor gelebt hat: Paris oder Japan. Federmair liebt das Chiffrieren und das Verrätseln, das Setzen von Variablen. Ein Gutteil der Qualität seiner Texte speist sich aus diesem Spiel der Anspielungen. Wer jedoch all die Anspielungen dechiffrieren möchte, wird sich lange mit dem Buch auseinandersetzen müssen.
Die entscheidende Frage ist, ob die Texte auch für einen Leser funktionieren, dessen Lust auf das Decodieren nur beschränkt ist. Ich meine ja. Weil die Qualität der Sprache (trotz manch schräger Metapher) absolut überzeugt und die Form stimmt. Wer nicht alles versteht, verstehen will, lässt sich einfach im Strom des Federmairschen Erzählflusses treiben, ans Ufer wird er immer gelangen.
Einer der schönsten Texte ist „Maliks Schenke“, eine untypische Araberspelunke, die von Nordafrikanern, Einwanderern und Vertriebenen aus aller Herren Länder frequentiert wird. Angezogen sind sie von der „verzweifelten Schönheit des Geschehens“ – tanzender Mädchen – und vom nicht eben vorteilhaft aussehenden Malik. „Ganz klar, die Bewunderer sind abhängig von Malik, sie sind ihrem kehlköpfigen König hörig, ohne ihn sind sie nichts, mit ihm halten sie ihr Leben aus, von einer Erleuchtung zur nächsten, dazwischen das Warten, Auf-dem-Barhocker-Sitzen, Bierglas in Reichweite, die Versuche, den König günstig zu stimmen.“
Berührend ist der Text „Regenschirme“, in dem Federmair mit seiner Tochter Yoko das Friedensmuseum von Hiroshima, wo der Autor seit mehreren Jahren lebt, besucht. Der Text zeigt die Unmöglichkeit beider, des Kindes und des Erwachsenen, die Katastrophe der Atombombe, dies gewaltige Leid zu begreifen.
Federmair schreibt über japanische Tempel: „Auf den Schiebetüren der Tempel ist die Wirklichkeit fast immer in äußerster Reduktion dargestellt: drei oder vier Blüten anstelle der Blütenpracht, ein Zweig anstelle des Geästs, ein Baum anstelle des Walds. Die Wirklichkeit ist Fülle und Überfülle, aber das heißt auch: Wiederholung, Verwirrung, Gestotter, Ablenkung, Fehler. Das Einzelding kommt in der Leere zum Recht seiner Vollkommenheit, und das Einzelne enthält dann alles.“ Man setze für die Wirklichkeit den Roman, für das Einzelding einen Federmairschen Prosatext.