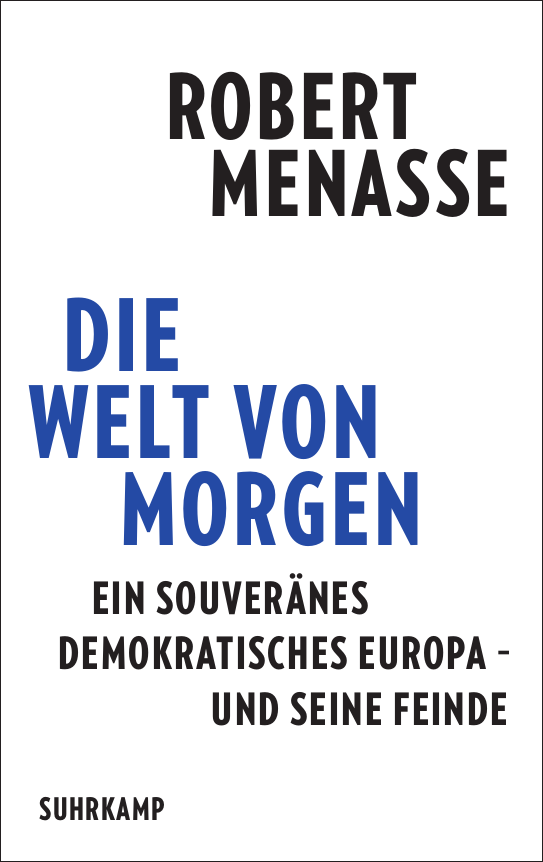Dass Menasse mit einem Buch zur Wahl Partei für das Projekt der politischen Einigung Europas ergriff, kam nicht eben überraschend. Spätestens mit seinem ersten langen Europa-Essay Der Europäische Landbote (Zsolnay, 2012) hatte sich der Wiener Romancier und Essayist als Intellektueller entschlossen der europäischen Sache verschrieben. Sein Engagement artikulierte sich in den folgenden Jahren in zahlreichen Interviews, Podiumsgesprächen, Zeitungsbeiträgen und Reden, gesammelt etwa in Heimat ist die schönste Utopie. Reden (wir) über Europa (Suhrkamp, 2014).
Öffentlichkeitswirksame Höhepunkte waren die Festrede Kritik der Europäischen Vernunft anlässlich des sechzigjährigen Jubiläums der Römischen Verträge vor dem Europäischen Parlament 2017 oder die Kunstintervention European Balcony Project 2018, in deren Rahmen von Theater- und Museumsbalkonen in ganz Europa ein gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot und dem Theatermacher Milo Rau verfasstes Manifest zur Ausrufung einer Europäischen Republik verlesen wurde. Dieses Europaengagement prägte indessen nicht nur die Essayistik und politische Publizistik Menasses, sondern auch sein jüngeres erzählerisches Werk. Mit Die Hauptstadt (2017) und Die Erweiterung (2022) legte er zwei unterhaltungsstarke Romane vor, in denen der bürokratische Apparat europäischer Institutionen und europäischer Diplomatie literarisch mit Leben erfüllt werden sollte, insbesondere mit jenem ihrer sonst wenig sichtbaren administrativen Eliten.
Die Welt von morgen ist Menasses bislang umfangreichster Europa-Essay. In 38 Kapiteln unterschiedlicher Länge und unterschiedlichen Gehalts stellt er seine Sicht auf die europäische Idee und „das nachnationale Europa under construction“ dar – auf „eine Utopie“ (S. 15), die aus der beispiellosen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts hervorgegangen ist und aus der nach 1945 „ein realer historischer Prozess“ wurde. Heute befinden wir uns laut Menasse mittendrin in diesem Prozess, kaum absehbar sei, wie es weitergehe. Im Kapitel Der Status quo liefert der Autor eine konzentrierte Gegenwartsanalyse: Nach Jahren der „Verwaltung des Stillstands“ (S. 23) und des Rückbaus europäischer Demokratie während der Kanzlerschaft Angela Merkels zeichne sich angesichts der sich verschärfenden multiplen Krisen der Gegenwart – genannt werden: Finanzen, Haushalt, Schulden, Migration, Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Handel, Energie, Inflation, Klima – Bewegung im Machtgefüge der Union ab.
Der Verzicht auf nationale Souveränität zugunsten gemeinschaftlichen Reagierens auf die drängenden Probleme der Gegenwart sei jedoch stets anlassbezogen und situativ. Einen ernsthaften Willen, „nationale Politiken“ nachhaltig „in Gemeinschaftspolitik überzuführen“ und damit den „nächste[n] Schritt in der Demokratiegeschichte“ zu gehen (S. 29), erkennt Menasse bei den Verantwortlichen nicht. Die konkrete Utopie der EU-Gründergeneration sei verschüttet, „Geschichtsvergessenheit und Visionslosigkeit“ (S. 30) dominierten die öffentliche Debatte ebenso wie die Hinterzimmer der Macht. Zwar würden die „Demokratiedefizite der EU […] allgemein erkannt“ (S. 188), Bestrebungen zur grundlegenden Demokratisierung der Union seien hingegen nicht zu verzeichnen. Souveränität und demokratische Legitimität reklamierten die Nationalstaaten lieber für sich allein.
Umfangreichere Kapitel wie dieses zählen zu den inhaltlich interessantesten und stilistisch überzeugendsten Abschnitten des Essays, in denen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der europäischen Idee und der Versuche ihrer institutionellen Umsetzung abgehandelt werden. Zu nennen wären die Kapitel zu Mitteleuropa als historische Inspirationsquelle für ein zeitgemäßes Denken von Regionalität und zur Kritik des ideologiegeladenen Vokabulars im gegenwärtigen Europadiskurs oder das Kapitel mit dem von Musil geborgten Titel Der deutsche Mensch als Symptom über den neuen „Führungsanspruch Deutschlands“ (S. 95) in der Union mit einer glänzend zugespitzten Analyse der deutschen Renationalisierung seit der Wiedervereinigung, die Menasse „nicht als Fest wiedererstandener Freiheit, sondern als Fest der Wiederauferstehung einer vermoderten Nationsidee“ (S. 108 f.) interpretiert.
Insgesamt findet sich auf den 192 Seiten der Welt von morgen allerhand: Lagebeschreibungen mit historischer Tiefenschärfe neben outriert polemischen Spitzen, etwa wenn auf knappen drei Seiten das Völkerrecht pauschal als „Farce“ (S. 58) abgefertigt wird; definitorische Pointen und treffende Kommentare zum Zeitgeschehen neben Bemerkungen an der Grenze von Aperçu, Kalauer und Gemeinplatz; informative Wissensreferate neben forciert didaktischen Passagen wie einem imaginierten Gespräch mit dem griechischen Politiker Kleisthenes über die attische Demokratie, um deren demokratische Defizite aufzuzeigen.
Einigen Raum nehmen auch Berichte aus Lebenswelt und -geschichte des Autors ein, etwa die Schilderung des idyllischen Landwohnsitzes im Waldviertel nahe der vormals hochgerüsteten österreichisch-tschechoslowakischen Grenze, entmutigende Erfahrungen aus der Beteiligung an einem Thinktank im Umkreis des ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso oder die Reflexion über die spezifische Perspektive des überzeugten Wieners und Europäers Menasse auf das problematische Verhältnis von Österreich und Deutschland. Menasse reizt den Spielraum der Gattung Essay voll aus, bis hin zur abgeklärten Bemerkung, dass er sich selbst widerspreche: „Das beruhigt mich. Widersprüche sind die Voraussetzung für Diskussionen“ (S. 167).
Der im Titel des Buchs aufgerufene Stefan Zweig hatte sich in seinen im amerikanischen Exil niedergeschriebenen Memoiren Die Welt von Gestern (1942) eine „Welt der Sicherheit“ und bürgerlichen Freizügigkeit in der Habsburgermonarchie vor dem Ersten Weltkrieg vergegenwärtigt, während er ob der Aussichtslosigkeit seiner von Nationalismus und Faschismus in Europa zerstörten Bemühungen um Frieden und Völkerverständigung zunehmend verzweifelte. Menasse selbst verwahrt sich hingegen ausdrücklich gegen eine Idealisierung der Vergangenheit und Habsburg-Nostalgie.
Auch eine Idealisierung der Gegenwart wird man ihm kaum vorwerfen können. Seine Kritik an der Realität der europäischen Institutionen ist entschieden und durchaus konkret. Er bespricht detailliert demokratiepolitische Mankos der Europäischen Union, die er allerdings als Effekte nationalen Eigensinns und der Weigerung, nationale Souveränität zugunsten des Gemeinschaftsprojekts aufzugeben, darstellt. Besonders deutlich wird das im zentralen Kritikpunkt an der vertragswidrigen de facto Hegemonie des Europäischen Rats der nationalen Staats- und Regierungschef:innen als „Supergesetzgeber“ (S. 157) über Parlament und Kommission, die Menasse als „Putsch der Nationalisten im System der Europäischen Union“ (S.158) benennt. Er bleibt indessen nicht bei der Problemanalyse stehen, sondern nennt eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen für eine Politik der kleinen Schritte.
In Summe behält Menasses entfesselter Möglichkeitssinn die Oberhand über seinen bisweilen von Frustration herausgeforderten Wirklichkeitssinn: „Man möchte zum EU-Gegner werden, wenn man sich mit dem Zustand der EU und ihren unproduktiven Widersprüchen beschäftigt, aber ich bestehe darauf: die Idee zu verteidigen, die Abwege zu kritisieren und endlich zu diskutieren, kühn denkend, worum es der Idee nach geht, ein souveränes, demokratisches, nachnationales Europa“ (S. 159). Idealismus und politische Imaginationskraft Menasses sind erklärtermaßen zukunftsgerichtet. – Das sehen freilich nicht alle so.
Im Jahr 2017 hat sich der renommierte deutsche Historiker Heinrich August Winkler in einem streitbaren Artikel im Spiegel unter dem Titel Europas falsche Freunde gegen Menasse und seine Mitstreiter:innen gewandt. Winkler warf Menasse nicht nur postfaktische Geschichtsklitterung mittels Fabrikation von Zitaten vor, die die Überwindung der Nationalstaaten als demokratiepolitische Vision der EU-Gründergeneration belegen sollten, sondern auch, dass die Vorstellung eines Europas der Regionen „Produkt ahistorischen Wunschdenkens“ sei. Die Bewohner:innen zumal der ökonomisch und infrastrukturell benachteiligten Regionen Europas wüssten sehr genau, dass Nationalstaaten die zuverlässigsten Garanten für „Rechtsstaat, Sozialstaat und Demokratie“ seien, Nationalstaaten wohlgemerkt, die ohnehin bereits „Teile ihrer Hoheitsrechte gemeinsam ausüben und andere Teile auf supranationale Einrichtungen übertragen haben.“
Besonderen Anstoß nahm Winkler an Menasses erstmals prominent im Europäischen Landboten vorgestellten Konzept der Ablösung nationalstaatlicher durch nachnationale Demokratie in Europa. Angaben dazu, wie dieser Prozess zu bewerkstelligen sei und wie sein Ergebnis aussehen könne, blieb Menasse damals schuldig. Der reformerischen Kraft der von Menasse gefeierten aufgeklärten Verwaltungseliten der Union wollte Winkler in Anbetracht ihrer fehlenden demokratischen Legitimierung die Gestaltung der Demokratie in Europa jedenfalls nicht überlassen.
Ohne ausdrücklich auf diese Kritik einzugehen, vertieft Menasse in Die Welt von morgen einerseits sein Konzept von Regionalität in der Auseinandersetzung mit Geschichte und Theorie des Kulturraums Mitteleuropa. Ein auch für heute hochinteressanter Punkt ist dabei das Statut der Personalautonomie aus der Rechtsgeschichte der späten Habsburgermonarchie und aus der frühen Ideengeschichte der österreichischen Sozialdemokratie. Die Personalautonomie sollte Individuen unterschiedlicher (nationaler) Gruppenzugehörigkeit staatsbürgerliche Rechte garantieren, ohne sie auf ein national definiertes Territorium festzulegen und eignete sich mithin besonders für Gebiete mit ethnisch und national durchmischter Bevölkerung.
Andererseits widmet Menasse konkreten Vorschlägen zur rechtlich gedeckten progressiven Demokratisierung der EU gleich mehrere Abschnitte seines Essays. Auffällig ist, dass dagegen die seit Winkler wiederholt kritisierte Verklärung der europäischen Beamtenschaft zum aufklärerischen Akteur von oben massiv heruntergefahren wird. Stattdessen führt Menasse gleich zu Beginn der Welt von morgen die Genealogie seines eigenen europäischen Denkens auf die Anfänge deutscher Aufklärung zurück.
Aus dem Fundus der florierenden Zeitschriftenliteratur des frühen 18. Jahrhunderts holt er ein Leipziger Magazin mit dem Titel Der Europäische Niemand hervor, das „eine kritische Reflexion von Zeitgenossenschaft, aber mit dezidiert europäischer Perspektive“ (S. 7) biete und die Utopie „von einem friedlichen, sozialen Europa, das in kultureller Vielfalt verbunden ist“ (S. 9). Der „Europäische Niemand“ ist, so der Titel der Zeitschrift weiter, einer, der „Niemanden zu beleidigen/Jederman aber nützlich zu seyn/beflissen ist“ (S. 7).
Davon ausgehend eröffnet Menasse mit aufklärerischer Verve ein fortschrittsfreundliches Nachdenken über die Zukunft Europas und seiner Bürger:innen, die es „mit Informationen“ zu versorgen und so von ihren „Vorurteilen“ und „ideologischen Verblendungen“ (S. 7) zu befreien gelte. Dem europäischen Niemand in seiner Entwicklung zum europäischen Jedermann zu helfen, sei die Aufgabe.
Nun handelt sich Menasse durch diesen affirmativen Traditionsbezug allerdings auch die notorische Sprechhaltung populärer Aufklärung (früher sagte man: Volksaufklärung) ein. Die ist gekennzeichnet von Paternalismus gegenüber ihren Adressat:innen. In der wiederholten Aufnahme des Motivs vom „Europäischen Niemand“ konterkariert Menasse in rhetorischen Fragen denn auch den bekundeten Willen zur Diskussion. Auf Thesen und Erläuterungen folgen rhetorischen Fragen wie „Kommt diese Geschichte Niemand bekannt vor?“ (S. 9) oder noch direkter: „Weiß das niemand?“ (S. 12)
Hinzu kommen Hinweise auf die Selbstverständlichkeit des Vorgetragenen: „Das ist so banal, dass man sich wundert, es überhaupt sagen zu müssen.“ (S. 166) Die didaktische Dimension des Essays gerät an mehreren Punkten zum schulmeisterlichen Dünkel gegen die vermeintlich ressentimentgeladenen Massen und ihre gewählten Vertreter:innen: Die Befürwortung nationaler Souveränität sei „ziemlich dumm“, schreibt er, „wissend, dass die Dummen nicht sich selbst dumm finden, sondern mich“ (S. 13). Wer will so mit sich reden lassen? Vermutlich niemand.
Trotzdem wünscht man der von Menasse erhofften Diskussion seiner Thesen und Forderungen Glück – und in wesentlichen Punkten Gehör an den richtigen Stellen. Schließlich ist zu hoffen, dass die Idee einer nachnationalen Demokratie in Europa sich nicht als Phantasma in einer postdemokratischen Welt multinationaler Konzerne und technokratischer Verwaltung erweisen wird.
Thomas Assinger, geb. 1989 in Villach, ist Literaturwissenschaftler und Literaturvermittler, er arbeitet derzeit als Senior Scientist am Stefan Zweig Zentrum der Universität Salzburg. Studium der Germanistik, Romanistik und Slawistik in Wien und Konstanz, Tätigkeit als Universitätsassistent für Neuere deutsche Literatur an den Universitäten Wien und Salzburg. Publikationen, Vorträge und Veranstaltungen zur österreichischen, deutschen und italienischen Literatur- und Kulturgeschichte ab dem 18. Jahrhundert mit Schwerpunkten auf Literatur und Theater der Aufklärung, klassischer Moderne und Gegenwartsliteratur.