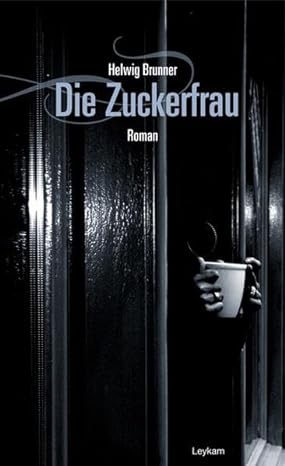Die Zuckerfrau ist eine Geschichte um eine flüchtige Liebe, die durch aktuelle politische Ereignisse gleichzeitig bedingt und verhindert wird. Die Möglichkeit der Liebe trotz der erlebten Schrecken eines gegenwärtigen Krieges und zugleich die Unmöglichkeit, legal die Mauern der Festung Europa zu durchdringen, erfahren in diesem schmalen Roman eine sehr überzeugende Bearbeitung.
Der Plot ist schnell erzählt: Paul, ein Übersetzer aus dem Italienischen in seinen mittleren Jahren, begegnet einer jungen Tschetschenin, die nach einer Lagerhaft in ihrem Heimatland den falschen Versprechungen eines Schleppers aufgesessen und in Österreich im letzten Moment der Prostitution entkommen ist. Die beiden werden mehr oder weniger schnell ein Paar und ebenso schnell wieder auseinandergerissen – wegen der Unerbittlichkeit der Fremdenrechtsbehörden, deren Denken in Paragraphen den Blick für die Individualität eines jeden Schicksals nicht zulässt. Das Ungewöhnliche an der Geschichte: die junge Frau hat in Grozny Germanistik studiert und spricht sehr gut – fast ein bisschen zu gut – Deutsch, womit der jungen Liebe eigentlich nichts im Weg steht. Zudem ist Jadranka – und hier dürfte der vermutlich einzige Rechercheschnitzer des Autors liegen, denn Jadranka ist kein russischer und schon gar kein tschetschenischer Name, sondern ein kroatischer oder vielmehr ein moderner exjugoslawischer Name, der von „Jadran“, der kroatischen Bezeichnung für die Adria, abgeleitet wird – eine sehr starke und selbstbewusste 24-Jährige, die zwar nach der Hölle, die sie in einem tschetschenischen Lager erlebt hat, sehr wohl traumatisiert ist, aber dennoch genügend Kraft und Zuversicht für einen Neuanfang mit sich bringt. Es ist die Ironie des Schicksals, dass ihr ausgerechnet ihre psychische Stabilität zum Verhängnis wird: im negativen Asylbescheid ist mehrfach zu lesen, dass eine Abschiebung „hinsichtlich der amtspsychologischen Befundlage medizinisch verantwortbar ist“, der Grad ihrer Traumatisierung nach etlichen Vergewaltigungen und körperlichen Misshandlungen quasi zu gering ist.
Die zarte Liebe zweier Menschen, die sich im Grunde gar nicht so sehr unterscheiden, ihr sanfter Anfang, die kurze Zeit des fast unbeschwerten Glücks und ihr jähes Ende bilden das Herzstück des Romans, ohne ihn monothematisch zu machen. Meisterhaft zeichnet der Autor die vorsichtige, aber stetige Entwicklung dieser Zuneigung und räumt auch ihren in der Tat ungewöhnlichen Umständen genügend Raum ein: Paul ist sich seiner Doppelrolle als fürsorglicher Helfer und Liebhaber bewusst, Jadranka geht es nicht anders. Der Übergang von der einen Situation in die andere, der den beiden dank ihrer Fähigkeit zur offenen Aussprache und ihrer grundsätzlichen Liebesfähigkeit gelingt, ist so glaubwürdig wie berührend, so behutsam wie detailgenau beschrieben.
Die „Zuckerfrau“ – der Titel bezieht sich keineswegs nur darauf, dass die in der Haft stark abgemagerte, ohnehin schon zierliche Jadranka ihren Tee prinzipiell mit Zucker trinkt, sondern bezeichnet auf nicht unoriginelle Weise, was die trotz allem lebenslustige Frau innerhalb weniger Wochen für den sensiblen und verantwortungsvollen Mann geworden ist – behandelt außerdem eine Reihe von weiteren Themen, die sehr geschickt die eigentliche Geschichte flankieren. Ganz zentral ist dabei das Problem der Einsamkeit des postmodernen Menschen. Das Phänomen des in Zeiten des massiven Verlusts aller Sicherheiten im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen fast zur Regel gewordenen Alleinlebens wird am Beispiel des Übersetzers Paul sehr deutlich: ein zu Hause Arbeitender, der noch dazu vor einigen Jahren aufs Land gezogen ist, muss damit leben, dass „an manchen Tagen […] das Telefon kein einziges Mal“ läutet und die Abende allzu lang werden: „Aber bei Dunkelheit hockt die Stille, die in diesem Haus anstelle von Menschen Wohnung genommen hat“. Der Autor bringt einige sehr interessante Gedanken zum Thema Vereinsamung als Begleiterscheinung einer bestimmten Lebensphase, so man den Zeitpunkt einer Bindung oder der Aufnahme in bestimmte feste Zirkel bewusst oder unbewusst verpasst hat.
Auch der Krieg als solcher ist ein Thema des Romans: zufälligerweise arbeitet Paul gerade an einer Übersetzung zur Eröffnung eines „Friedensmuseums“ am Brenner Pass, das die Ereignisse des Ersten Weltkriegs in dieser Gegend dokumentieren soll. Zugleich bekommt er das Angebot, den – ebenfalls im Ersten Weltkrieg spielenden – Roman eines in die Jahre gekommenen italienischen Schriftstellers zu übersetzen und stellt sich dabei die Frage nach der Relevanz dieser längst historisch gewordenen Thematik angesichts der unzähligen Kriege von heute. Gleichzeitig macht sich Paul über die Begrenztheit des kollektiven wie individuellen Gedächtnisses Gedanken; Jadranka hingegen, die den Krieg in seiner grausamsten Unmittelbarkeit, also am eigenen Leib erlebt hat, stellt die Sinnhaftigkeit der ausführlichen medialen Berichterstattung infrage: „Aber wer soll es lesen? Die es erlitten haben, werden nur neuerlich davon gequält. Die es getan haben, wird es nicht erschüttern. Und die nichts damit zu tun haben, für die bleibt es eine fremde Geschichte.“ Jedes Erleben ist vergänglich, stellt Paul schließlich fest: „Irgendwann werden Erschütterungen zu Geschichten und Geschichten zu Geschichte.“
Formal gesehen fällt im Text eines auf: trotz aller Nähe zu den Figuren, in erster Linie zum Protagonisten, bleibt eine Distanz spürbar, die ein eigenwilliger, allzu förmlich-steifer, oft betulich wirkender Stil schafft. An etlichen Stellen sind Brunners Formulierungen, egal, ob er sie Paul oder einem beobachtenden Erzähler in den Mund legt, bewusst umständlich, für die jeweilige Situation einfach zu hochsprachlich, zu ausführlich, zu kompliziert. Andererseits liest sich die „Zuckerfrau“ sehr flüssig. Es ist ein Stück solide erzählte, im besten Sinne des Wortes spannende Prosa mit etlichen überraschenden Wendungen. Zwei geschickt platzierte Ausflüge ins phantastische Fach runden sie ab.
Das, was der erfahrene Lyriker Brunner hier erzählt, ist zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. „Se non è vero, è ben trovato“, würde der Romanist Paul sagen, und sicher gleich hinzufügen, dass es das hübsche Sprichwort im Italienischen eigentlich gar nicht gibt. Das tut aber der Geschichte tatsächlich keinen Abbruch: Die Zuckerfrau ist als literarischer Text gelungen und in sich schlüssig und kann darüber hinaus als Plädoyer für einen differenzierteren Blick auf „den Flüchtling“ oder „den Asylwerber“ gelesen werden. Und das ist sicher nicht schlecht.