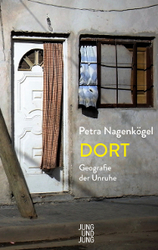Angekommen ist sie, die wie im Zitat als Du-, aber auch als Ich- und Wir-Erzählerin auftritt, in Buenos Aires. Warum sie an diesen Ort, zu diesem Dort gereist ist, sagt sie nicht direkt. Gleich nach der Ankunft fragt sie sich aber, ob es ihr „um die Verschiebung [ihrer] Fremdheit von da nach dort“ gehen könnte, da sie weder wisse „was es heißt anzukommen“, noch „was hier bedeutet.“ Fragen, die schon auf den ersten Seiten erahnen lassen, dass es sich bei Dort nicht um einen Reisebericht im traditionellen Sinne handelt, obwohl eine Reise nach Argentinien und viele Reisen innerhalb der Grenzen dieses Landes beschrieben werden. Denn die Erzählerin behält die skeptische, zweifelnde Einstellung des Anfangs konsequent über das ganze Buch bei. Es ist ein Zweifel am Selbst und an dessen Wahrnehmung.
Auf den Rausch der Ankunft folgt bereits am Weg vom Flughafen zur Stadt die Ernüchterung. Die Erzählerin merkt, dass die Beantwortung ihrer Fragen in Buenos Aires schwierig sein wird, da die Stadt ständig an ihrer „nie zu vollendenden Form schreibt, an einer Matrix der Vergänglichkeit“. Ist es überhaupt möglich zu erfahren, was Ankommen und was ‚hier‘ bedeutet, „in dieser Stadt, die wie jede und die wie keine andere ist“, deren Oberfläche „momentweise begreifbar wird als ungeordnete Anhäufung von Schichten im Raum und in der Zeit“? Vielleicht, doch geht es Nagenkögel nicht hauptsächlich um diese Fragen, sondern darum, das zu ergründen, was ihre Beantwortung verhindert: Die Unruhe.
Der Nebentitel des Buches, der es als eine Geografie der Unruhe ausweist, könnte in dieser Hinsicht auch als Gattungsbezeichnung gelten. Denn in den dreißig Kapiteln von Dort lässt Nagenkögel ihre Erzählerin durch Buenos Aires und seine Umgebung streifen, wo sie stets mit der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit ihrer Beobachtungen in Raum und Zeit konfrontiert wird. „Ich möchte die Zeit anhalten und ruhigstellen können, wünsche mir den Stillstand einer Sekunde, um die Bilder im Einzelnen abzugehen“, sagt sie einmal.
Die Zeit kann nur in Ausnahmefällen angehalten werden. Etwa mit einer Stoppuhr. Seit ihrer Erfindung verhindert jedoch in vielen mechanischen und elektromechanischen Uhren die Unruh das Stillstehen der Sekunden: Eine Unruh ist laut Duden ein „kleines Schwungrad in einer Uhr, das ihren gleichmäßigen Gang bewirkt“. Die Unruhe ist der Zeit inhärent.
Gerade weil der Erzählerin ein Anhalten der Zeit nicht gelingt, schreibt sie eine Geografie „der Unruhe dessen, was wir Moderne nennen“. Auch wenn dieses Vorhaben nicht direkt ausgesprochen wird, ist es dem Buch eingeschrieben. Immer wieder wird der „Lauf der Moderne“ zwar als ein Bild thematisiert, „das zerfällt, sobald du es fassen möchtest“, was in der Erzählerin zugleich „Trauer und Erleichterung“ auslöst, doch sammelt sie in Buenos Aires und seiner Umgebung unermüdlich nach den vergänglichen Belegen dieser Unruhe. Und sie sieht nicht nur genau hin, sondern lässt in ihre detailreichen Beobachtungen eben auch Überlegungen zu deren Vergänglichkeit mit einfließen.
Das ist schon an der Schreibung der Kapitelüberschriften ersichtlich. Wenn die Unruhe kategorisiert werden soll, muss sie, wenn sie schon nicht angehalten werden kann, zumindest eingegrenzt werden. Im ersten Kapitel kommt die Erzählerin in der Früh in Buenos Aires an, doch sind dessen „Grenzen […] um diese Zeit noch nicht festgeschrieben“. Deshalb trägt dieses Kapitel wohl noch keine Überschrift. Alle folgenden haben eine. Das zweite etwa /sichtbar werden/. Bis auf diese erste und eine weitere Überschrift, die ebenfalls um ein Adjektiv ergänzt wird, ist es aber immer ein Infinitiv. Das ist ein Problem: Infinitiv leitet sich vom Lateinischen infinitum, das Unbegrenzte, ab. Da eine unbegrenzte Kategorie keine ist, muss Nagenkögel die Infinitive zwischen zwei Schrägstriche stellen. Diese grenzen in /sichtbar werden/ nicht nur die Unbegrenztheit auf konkrete Beobachtungen der Erzählerin, sondern, in ihrem Bewusstmachen, auch deren Vergänglichkeit ein:
Sie sieht, wie ein Junge mit seinem Spiegelbild im Auslagenfenster eines Reisebüros spielt. Bald ist nicht mehr klar, ob er sein Spiegelbild imitiert oder umgekehrt, was also real und was Simulation, wer Beobachter und was Beobachtetes ist. Die Erzählerin beschreibt dieses Bild und merkt an, dass sich das Reisebüro nahe jener Stelle befindet, wo sich die Calle Defensa, die Straße der Verteidigung, mit der Avenida Independencia, der Allee der Unabhängigkeit kreuzt. Von dieser Kreuzung aus winkt der „Junge der Erinnerung an sich selbst, rückt sie in eine Unmittelbarkeit, in der er bleiben kann, was er eben noch war.“ Aus der Distanz sieht er sein Spiegelbild nicht mehr, er kann sich nur daran erinnern.
Eine weitere Erklärung dieses durch die Spiegelung und Erinnerung auf zweifache Art vergänglichen Bildes gibt die Erzählerin nicht. Will sie mit seiner genauen geographischen Verortung andeuten, dass sich der Junge beim Zurückschauen seine Unabhängigkeit von seinem Spiegelbild bewusst macht, sich gegen eine Verdoppelung verteidigt und so seine Einzigartigkeit bewahrt? Das ist vielleicht etwas weit hergeholt, doch ist dies eine der Stärken von Nagenkögels Buch: Es lädt zum Philosophieren ein.
In den folgenden Kapiteln beschreibt die Erzählerin viele solcher Unruhen. Nicht immer bleiben sie bloß sicht-, sondern werden auch fühlbar. Zum Beispiel in Zug- und Busbahnhöfen, wo sie viel Zeit mit Warten verbringt. Einmal beschreibt sie das Warten als ein Feststecken „in einer leeren, formlosen Zwischenzeit, die ohne bestimmbares Ende ist und sich anfühlt, als wäre sie doppelt und dreifach geschenkt“. Diese Formlosigkeit lässt sich aber von den Wartenden nicht sinnvoll füllen, sei es durch Drehen der Armbanduhr am Handgelenk, sei es durch Lesen, sodass auch diese geschenkte Zeit vergänglich bleibt.
Ein drastischeres Fühlbarwerden der Unruhe und ein Gegenteil zur Formlosigkeit des Wartens muss die Erzählerin erfahren, als sie auf offener Straße bestohlen wird. Ihr „Verstand implodiert und lässt alles gleichzeitig erscheinen“. In den Tagen nach dem Überfall trägt sie dieses Gefühl der überwältigenden Gleichzeitigkeit als „eine kaum ertragbare Unruhe“ in sich.
Ist der Überfall unzweifelhaft der Tiefpunkt ihrer Erforschung der Unruhen, ist das Kapitel ‚begehren‘ sicherlich ein Höhepunkt für die Erzählerin. Sie spürt hier dem Werk des uruguayischen Schriftstellers Juan Carlos Onetti nach. Dieser lässt im Roman Das Kurze Leben seinen Protagonisten Juan María Brausen die fiktive Kleinstadt Santa María erfinden, die sich, wie die Erzählerin sagt, mit jedem Roman Onettis vergrößert und das „Paradox einer gleichsam in den Stillstand getriebenen Rastlosigkeit“ darstellt. Also eigentlich das Ziel ihrer Geografie: Die Unruhe wird in der Literatur im Stillstand gebannt. Doch zweifelt sie und fragt sich, was bestürzender sein könnte, als dieser zur Dauer gezwungene „Zustand der Immanenz“. Ein Eingeständnis des Scheiterns?
Nein. Vielmehr beschließt sie, eines der vielen realen Santa Marías in Lateinamerika zu besuchen. Ein Mann namens Pedro nimmt sie ein Stück auf seinem Motorrad mit. Bei ihm und seiner Familie kann sie zu Mittag essen und wird mit der Fremdheit Europas konfrontiert. Für Pedro und seine Frau Lucia ist Europa „allenfalls der Schauplatz überlieferter Erzählungen, die so weit zurückreichen, dass sie längst nicht mehr wahr sein können.“
Nach dem Essen bringt Pedro sie nach Santa María. Beim Abschied hebt Lucia den Arm ihres kleinen Kindes hoch und „es imitiert unser Winken“. Der Erzählerin „kommt […] vor, als hättest du für einen Moment ein Zuhause gehabt.“ Sie ist angekommen. Oder ist das nur eine Imitation, wie das Winken des Kindes, eine Imagination wie das Santa María Onettis oder das Europa der Erzählerin?
Eine Antwort gibt es auch hier nicht. Das könnte man Dort als Mangel ankreiden. Doch wie gesagt besteht der Reiz des Buches gerade im Zweifel seiner Erzählerin. Und wird die Unruhe nicht auch vom Nachdenken, vom Fragestellen angehalten?